Wie demokratisch war der Obrigkeitsstaat? Zur Einleitung
Markus Lang
Am 29./30. Oktober 2020 trafen sich 40 Expertinnen und Experten, um über die Stellung des Kaiserreichs in der deutschen Demokratiegeschichte zu diskutieren. Die Tagung sollte eigentlich in der Mendelssohn-Remise in Berlin stattfinden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch kurzfristig als Online Workshop abgehalten.
Warum eine wissenschaftliche Tagung zum Kaiserreich? Und was hat ein häufig als monarchischer Obrigkeitsstaat bezeichnetes politisches System mit Demokratie zu tun?
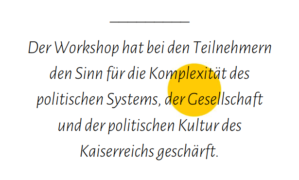
Der unmittelbare Anlass für die Tagung war das 150-jährige Jubiläum der Reichsgründung am 18. Januar 1871. „Wie kann man dieses Jubiläum heute angemessen begehen?“, so eine der zentralen Fragestellungen der Tagung und dieses Tagungsberichts. Diese Frage so zu stellen, bedeutet gleichzeitig, dass es auch „unangemessene“ Formen des Erinnerns gibt. In der Tat findet man in den letzten Jahren mehr und mehr Versuche, das Kaiserreich gegen die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft und anderer Geistes- und Sozialwissenschaften für rechtspopulistische und rechtsextreme Traditionsbildung zu vereinnahmen oder in eine „geglättete“ deutsche Geschichte zu integrieren. Zuletzt hat etwa der Streit um die Farben des Kaiserreiches und ihre Instrumentalisierung für geschichtsrevisionistische Absichten für Diskussion gesorgt. Die Teilnehmer der Tagung waren sich einig, dass diesem Missbrauch mit differenzierten aber gleichzeitig leicht zugänglichen Darstellungen aktueller Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit begegnet werden soll.
Diese Darstellungen ordnen wir in eine Demokratiegeschichte ein. Unter Demokratiegeschichte verstehen wir das individuelle und gesellschaftliche Ringen um die Verwirklichung von Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im historischen Prozess, egal ob die konkreten Bemühungen im Einzelfall unmittelbar von Erfolg gekrönt waren oder nicht.
Vorträge und Diskussionen der Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten die ambivalente Rolle heraus, die dem Kaiserreich in diesem historischen Prozess zukommt. Selbstverständlich war es ein Obrigkeitsstaat, ohne Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Volk bzw. dem Reichsparlament. Gleichzeitig fanden die Wahlen zum Reichstag unter einem im internationalen Vergleich wegweisenden allgemeinen und freien Männerwahlrecht statt. Als der Staat sich von der aufsteigenden Sozialdemokratie bedroht sah, reagierte er mit dem repressiven „Sozialistengesetz“. Die Repression führte aber eher zu einer Mobilisierung und Stärkung der Arbeiterbewegung und keinesfalls zu deren Zerschlagung. Parteien konnten im Reichstag und in den Landtagen ein Kompromiss-Dispositiv ausbilden und strategische Bündnisse erproben, allesamt wichtige demokratische Verhaltensmuster. Ohne die Möglichkeit zur Übernahme von Regierungsverantwortung wurde jedoch gleichzeitig eine Haltung der politischen Verantwortungslosigkeit und permanenten Opposition befördert. Auf kommunaler Ebene eröffneten sich Handlungsspielräume und Partizipationsmöglichkeiten für bislang ausgeschlossene soziale Gruppen, wie am Beispiel der Sozialdemokratie und der Frauen herausgearbeitet wird.
Der Workshop hat bei den Teilnehmern den Sinn für die Komplexität des politischen Systems, der Gesellschaft und der politischen Kultur des Kaiserreichs geschärft. Mit der Veröffentlichung der Beiträge wollen wir diese Erkenntnisse mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen.
1. Verfassung und politisches System
Im Bereich der Verfassungsordnung zeichnen die Beiträge ein gemischtes Bild. In der Interpretation der Verfassung war kaum Raum für demokratische Ideen geschweige denn demokratische Praktiken. Auch das Staatsoberhaupt war sehr auf die Wahrung der monarchischen Macht bedacht. Auf der Ebene des Föderalismus finden sich jedoch Strukturen und Mechanismen, die einem autoritären „Durchregieren“ entgegenstanden und stattdessen Kompromiss, Abstimmung und auf Konsens ausgerichtete Verhandlungen zwischen vielfältigen Akteuren notwendig machten.
Michael Dreyer verfolgt die Diskussion um die Verfassung des Kaiserreichs von der Verfassungsgebung 1867 im Norddeutschen Bund bis zum Ersten Weltkrieg. Dreyer charakterisiert das Reich als „klassische[s] Modell einer konstitutionellen Monarchie“ mit einem für die Zeit „bemerkenswert demokratischen Wahlrecht“. In der staatsrechtlichen Diskussion allerdings habe Demokratie praktisch keine Rolle gespielt, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit dem demokratisch gewählten Reichstag. Führende Wissenschaftler und Kommentatoren beschäftigten sich stattdessen mit der Frage der Souveränität im Bundesstaat. Erst im Vorfeld des Ersten Weltkriegs sei es zu einer ernsthaften Beschäftigung mit Demokratie als politischem System gekommen, wobei die Autoren durch die Bank die konstitutionelle Monarchie des Kaiserreichs als überlegen ansahen. Immerhin, man setzte sich mit der Demokratie auseinander, was Dreyer als Indikator für die Wahrnehmung einer normativen Bedrohung der konstitutionellen Monarchie interpretiert. Aber: „Warnende Stimmen […], die die Stärkung der Demokratie verlangen, wurden im deutschen Obrigkeitsstaat überhört, bis es zu spät war.“
Jan Markert fokussiert seinen Blick auf die Person und das Herrschaftsverständnis Wilhelms I. Er stellt dem gängigen Bild Wilhelms, der sich für Politik kaum interessiert habe, eine alternative Betrachtung entgegen, die den Kaiser als zutiefst politische Figur interpretiert. Die Gründung und den inneren Ausbau des Kaiserreichs stellt er als Kulmination eines langfristigen antirevolutionären monarchischen Projekts Wilhelms I. dar. Der von der Forschung bislang weitestgehend marginalisierte erste Deutsche Kaiser hatte seit den Revolutionserfahrungen 1848/49 die Ziele einer Konstitutionalisierung und Nationalisierung der Hohenzollernmonarchie verfolgt, um so die gefährdete Stellung der Krone zu stärken. Die Reichsgründung stellte den Höhepunkt dieses „dynastischen Hijackings“ der Deutschen Frage dar. Sowohl vor als auch nach 1871 spielte Wilhelm I. eine zentrale Rolle im politischen Entscheidungszentrum Berlin, wo es nie zu einer Unterordnung des Kaisers gegenüber dem „Eisernen Kanzler“ Otto von Bismarck kam. Vielmehr agierte Bismarck stets in den Bahnen, die Wilhelm I. ihm vorgab, so Markert. Dieses monarchische Herrschaftsverständnis Wilhelms I. sollte die Geschichte des deutschen Kaiserreichs insgesamt nachhaltig und entscheidend prägen.
Für Oliver Haardt ist dagegen der Bundesrat das zentrale Organ der Verfassung, das in allen drei Zweigen der Staatsgewalt ganz entscheidende Befugnisse besaß. Der Bundesrat war damit laut Haardt eine Sicherheitsvorkehrung zum Schutz monarchischer Macht. Vor allem fiel ihm die Rolle einer Reichsregierung zu, da die Verfassung offiziell keine derartige Institution einrichtete. Die Länderkammer bestand aus den Gesandten der monarchischen Einzelstaaten und der drei Hansestädte. Da diese Bevollmächtigten nur ihren jeweiligen Regierungen gegenüber verantwortlich waren, konnten sie weder individuell noch in ihrer Gesamtheit vom Reichstag zur Rechenschaft gezogen werden. Damit war für Haardt eine Parlamentarisierung des föderalen Verfassungsgefüges in der Gestalt, in der es 1871 geschaffen wurde, unmöglich. Eben diese Gestalt änderte sich jedoch in den Jahrzehnten nach der Reichsgründung fundamental. Mehrere strukturelle Wandlungsprozesse drängten den Bundesrat in ein politisches Schattendasein, das seine Funktion zur Verhinderung parlamentarischer Übergriffe langsam aushöhlte. Eine besonders wichtige Rolle spielte die Manipulation der inneren Zusammensetzung des Bundesrates. Durch die Übernahme der preußischen Bank und die Etablierung eines komplexen Substitutionssystems unter den Kleinstaaten machte die mit den Jahren um den Kanzler entstehende Reichsregierung den Bundesrat zu einem Satellitenorgan. Infolgedessen konnte die Regierung sich aber auch nur noch mehr schlecht als recht hinter dem Bundesrat verstecken, um den Angriffen des Reichstages auszuweichen.
Auch für Paul Lukas Hähnel ist die föderale Staatsstruktur des Kaiserreichs die zentrale Analyseebene. Die Forschung hat dem Föderalismus oftmals unter dem Postulat der preußischen Hegemonie und des „Scheinföderalismus“ nur sekundäre Bedeutung beigemessen. Hähnel plädiert jedoch dafür, die dezentrale Staatsstruktur als ein generelles gesellschaftliches Konfliktlösungsprinzip zu verstehen, denn die Reichsverfassung verband Exekutiv- und Verbundföderalismus miteinander. Landesexekutive und Reichsgesetzgebung waren institutionell verklammert, und ein Großteil der staatlichen Aufgaben ließ sich nur im Zusammenspiel von Reich und Gliedstaaten erledigen. Die Art und Weise, wie die Verfassung Kompetenzen zwischen den Staatsebenen verteilte, bedingte Koordinationszwänge, förderte ebenenübergreifende Kooperationen und begünstigte eine vertikale Verflechtung der Staatsebenen. Föderale Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse wurden dabei von konsensorientierten Verhaltensnormen geprägt.
Die Bedeutung dieser Aushandlungsprozesse auch jenseits der föderalen Strukturen betont ebenfalls Wolfram Pyta. Er argumentiert, dass der Kompromiss – verstanden als institutionalisiertes Ausgleichsverfahren zur Herstellung bindender Entscheidungen – zur Richtschnur der maßgeblichen Akteure in Parlament, Bundesrat und Parteien avancierte, je stärker sich der erste deutsche Nationalstaat etablierte. Pyta verweist darauf, dass eine sich immer mehr verfestigende Kompromisskultur die kulturelle Basis für kompromisshafte Handlungsmuster bildete. In methodischer Hinsicht besitzt dieser interpretatorische Neuansatz den Vorteil, dass er eine Brücke zu den Kulturwissenschaften schlägt. Er lädt zu der Frage ein, woher die semantische Karriere des Kompromiss-Begriffs rührt. Und er erlaubt Anschlüsse an literatur- und sprachwissenschaftliche Ansätze, mit deren Hilfe erklärt werden kann, warum der Terminus des Kompromisses zum normsetzenden Regeldispositiv aufsteigen konnte.
Dem stellt Theo Jung den Aktionsmodus des Streits und der Streitkultur entgegen. In älteren Darstellungen galt das Kaiserreich oft als Gesellschaft, die komplett auf den Befehlston ausgerichtet gewesen sei. Das Pendant zum Bild eines repressiven Obrigkeitsstaats war die Vorstellung einer diskussionsunfähigen Untertanengesellschaft. In jüngerer Zeit ist dagegen auf die vitale Diskussionskultur der Ära hingewiesen worden, die nicht zuletzt in den politischen Versammlungen zum Ausdruck kam. Mit Blick auf die Interaktionsformen dieser Arena hebt der Beitrag die Ambivalenzen der politischen Streitkultur des Kaiserreichs hervor. Während in den ersten Jahrzehnten des Regimes eine deliberative Versammlungsform vorherrschte, bei der Vertreter verschiedener Lager vor einem heterogenen Publikum miteinander ins Gespräch kamen, verschob sich der Schwerpunkt ab den 1890er Jahren zunehmend zur reinen Parteiversammlung, deren Funktion vor allem darin lag, die Geschlossenheit und Begeisterung des eigenen Lagers zu demonstrieren. Ruhiger wurden die auch zuvor schon sehr tumultuösen Versammlungen dadurch allerdings nicht. Vielmehr etablierte sich eine Parallelpraxis gegenseitiger Versammlungsstörungen und -sprengungen, die als physischer Revierkampf Teil der politischen Auseinandersetzung wurden.
2. Massendemokratie und Gesellschaft, Parlament und Parteien
Die ambivalente Bewertung des politischen Systems des Kaiserreichs setzt sich auf der gesellschaftlichen Ebene und bei den Parteien fort. Hedwig Richter weist darauf hin, dass die Massenpolitisierung in der Zeit des Kaiserreichs Inklusions- und Exklusionsprozesse befördert habe. Demokratisierungsprozesse entsprangen demnach den gleichen Wurzeln wie Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Militarismus und Misogynie, wobei Richter gleichfalls einfordert, diese Entwicklungen im internationalen Kontext einzuordnen, wo ganz ähnliche Entwicklungen zu beobachten waren. Richter untermauert ihre These anhand zweier Makroprozesse: eines generellen Wohlstandsanstiegs (im Sinne eines Anstiegs der Reallöhne) und des steigenden Nationalismus. Die Jahre um 1900 waren für Richter „eine Aufbruchszeit der Inklusion – und zugleich des Hochimperialismus.“ Entscheidend sei aber, die dunklen Entwicklungen in der Zeit der Hochmoderne nicht als genuin deutsches Problem zu „exotisieren“. Richter plädiert vielmehr dafür, das Kaiserreich und die dort angelegte Massendemokratisierung im internationalen Kontext nicht nur als Vorläufer des Nationalsozialismus zu betrachten, sondern auch als Vorläufer der demokratischen Aufbrüche der Weimarer Republik und der Bundesrepublik.

Für eine internationale Kontextualisierung des Kaiserreichs wirbt auch Christoph Nonn. Was Radikalnationalismus, Militarismus und Antisemitismus angeht, unterscheide sich das deutsche Kaiserreich anders als oft angenommen nicht wesentlich von den westeuropäischen Ländern. Nonn sieht jedoch in der Konstellation eines ausgesprochen demokratischen Wahlrechts in einer ausgesprochen undemokratischen Verfassungsstruktur eine Besonderheit, die den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte belastete. Weil die Macht des gewählten Parlaments eng begrenzt und einseitig negativ blieb, entwickelte sich im Kaiserreich eine Mentalität der politischen Verantwortungslosigkeit. Im engeren Sinn demokratische Tugenden wie die Bereitschaft zum Interessenausgleich durch Kompromiss in festen Parteikoalitionen, zur Übernahme von Verantwortung für die Zivilgesellschaft, zur Akzeptanz unpopulärer Entscheidungen konnten so kaum entstehen. Auf die 1918 dann etablierte parlamentarische Regierungsweise waren weder Parteien noch Bürger vorbereitet.
Die Entwicklung parlamentarischer Macht in einem politischen System (noch) ohne politische Verantwortung untersucht Sebastian Rojek am Beispiel des Konfliktes zwischen Parlament und Marine. Der erste Chef der Admiralität, General Albrecht von Stosch, verfolgte eine offenherzige Kommunikationsstrategie gegenüber dem Parlament und inszenierte die Seestreitkräfte als Symbol der geeinten Nation. Es gelang ihm, die Unterstützung vor allem der liberalen Parteien zu sichern und die Flottenpläne bewilligt zu bekommen. Dabei erweckte er aber den Eindruck, den Parlamentariern weitreichende Befugnisse über sein Ressort einzuräumen. Nach einer Schiffskatastrophe im Mai 1878 kam es zum Konflikt zwischen Reichstag und Regierung, denn nun konnten die Liberalen und ihre Medien gerade im Namen der Nation Aufklärung über die Ursachen des Unglücks verlangen. Den Höhepunkt der Krise bildete ein Misstrauensvotum gegen den Chef der Admiralität. Zwar scheiterte dies an den Mehrheitsverhältnissen, es zeigte jedoch den Willen des Parlaments, die Regierung und ihre Mitglieder parlamentarischer Kontrolle zu unterwerfen.
Michael Kitzing setzt sich mit der Entwicklung des badischen Nationalliberalismus auseinander. Anders als im Reich waren die Nationalliberalen in Baden über Jahrzehnte „Regierungspartei“, wobei sie vom starken Rückhalt des Großherzogs profitierten. Auch das bis 1905 geltende indirekte Landtagswahlrecht stärkte ihre Stellung. Aufgrund des Drucks von Linksliberalen, Zentrum und Sozialdemokraten kam es jedoch zur Einführung des direkten Wahlrechtes, wodurch die Nationalliberalen in die Defensive gerieten. Um ihre dominierende Position gleichwohl zu verteidigen, schlossen die Nationalliberalen zwischen 1905 und 1913 mit den Linksliberalen und den Sozialdemokraten Stichwahlabkommen. Aus diesen heraus entwickelte sich auch eine inhaltliche Zusammenarbeit der drei Parteien. Kitzing erläutert die lokalen und nationalen Entwicklungen, die zur Entstehung und zum späteren Scheitern dieser Wahlbündnisse beitrugen.
Während also die Nationalliberalen ihren Platz im neuen Nationalstaat wie selbstverständlich einnahmen, war das 1870/71 begründete Reich nicht das, was sich die junge sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der lang ersehnten staatlichen Einheit erträumt hatte. Das Reich blieb für sie eine „fürstliche Versicherungsanstalt gegen die Demokratie“, wie Walter Mühlhausen zeigt. Ihre Ablehnung der Kriegskredite 1870 machte sie zu „vaterlandslosen Gesellen“, gegen die sich der Staat in einer Abwehrsituation wähnte. Es folgten Ausgrenzung und Verfolgung (mit dem Sozialistengesetz 1878–1890 als Höhepunkt), auch wenn in der SPD der auf Integration ausgerichtete reformistische Flügel kontinuierlich an Einfluss gewann. Eine der Spätfolgen der Stigmatisierung der SPD war es, so das Fazit, dass die nationalistische Rechte sie für die Kriegsniederlage 1918 und ihre unmittelbare Folge, den Versailler Vertrag, verantwortlich machte. Die von den Sozialdemokraten, den „Novemberverbrechern“, getragene Revolution habe erst zu dieser Niederlage geführt. In solcher Sicht war die Republik ein Produkt des Verrats, dessen man die Sozialdemokratie schon immer verdächtigt hatte. Letztendlich erleichterte dieses Urteil, das aus dem in der Kaiserzeit geformten Stereotyp von der landesverräterischen SPD erwuchs, die Zerstörung der Weimarer Republik.
Jürgen Schmidt nimmt das von Mühlhausen bereits erwähnte Sozialistengesetz unter die Lupe. Dieses Sozialistengesetz, das von 1878 bis 1890 die politischen Aktivitäten der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung beschnitt, verdeutlicht für Schmidt den obrigkeitsstaatlichen Charakter des Kaiserreichs und gleichzeitig dessen Grenzen. Das Gesetz, dessen Ziel die Ausgrenzung der Arbeiterschaft und der Arbeiterbewegung war, erdrosselte diese politischen Kräfte keineswegs. Vielmehr schweißte es das sozialdemokratische Milieu zusammen, ließ eine schlagkräftige parlamentarische Opposition entstehen, die nach 1890 politischen und gesellschaftlichen Druck ausübte. Diese nicht intendierten Folgen von Bismarcks Sozialistengesetz zeigen die Bedeutung von politischem, zivilgesellschaftlichem Engagement sowie die Kraft parlamentarisch-oppositionellen Verhaltens gegenüber autokratisch-obrigkeitlichen Systemen. Diese Verhaltensweisen bilden so einen Referenzpunkt bis in die Gegenwart.
Den politischen Katholizismus sieht Stefan Gerber zum Zeitpunkt der Reichsgründung in der Defensivposition. Seit den 1830er Jahren sah die katholische Kirche ihre Autonomie von Säkularisation, Aufklärung und einer bürokratischen Staatskirchenpolitik bedroht. Als Konsequenz konstituierte sich der politische Katholizismus von Beginn an als Verfassungspartei, da die Verwirklichung kirchlicher und religiöser Freiheit im Staat nur noch im Rahmen konstitutioneller Grundrechtssicherung denkbar und möglich war. Im Rahmen der Kulturkampfgesetzgebung fand diese Positionierung ihre Bestätigung, das Zentrum profilierte sich als Partei der konstitutionellen Rechtssicherung und ging ähnlich wie die Sozialdemokratie gestärkt aus dem Konflikt mit dem Staat hervor. Zeitweise konnte die Partei über 85% der katholischen Wähler integrieren. Als Grundrechts- und Verfassungspartei, durch seine breite Mobilisierung im Kulturkampf, als Wahlrechts- und Sozialstaatspartei und durch ihre außerordentliche politische Integrationsfähigkeit, die sie im katholischen Milieu zur „Volkspartei“ machte, hat das Zentrum Entscheidendes zur Demokratisierung des Kaiserreichs beigetragen.
3. Kommunalpolitik und Demokratie
Die Bedeutung des Föderalismus für das Verständnis des politischen Systems des Kaiserreichs wurde bereits im ersten Abschnitt hervorgehoben. Die Betrachtung der kommunalen Ebene erweitert diese Perspektive und zeigt Ansätze demokratischer Handlungsspielräume und Experimentierfelder für die Integration neuer Gruppen in das politische System.
Lennart Bohnenkamp zeigt am Beispiel der Reichshauptstadt Berlin die Wechselwirkungen auf, die im tripolaren Spannungsfeld von Reich, Staat und Kommune erzeugt wurden. Er sieht dieses Spannungsfeld als eine Ursache für die Hyperkomplexität des Regierungssystems vor 1914 und leitet daraus eine Dysfunktionalität desselben ab. Seine Analyse des politischen Systems unter Einbeziehung der kommunalen Perspektive unterscheidet sich dabei deutliche von anderen Beiträgen in diesem Heft. Sein Fazit: Nicht die Blockade einer politischen Modernisierung sei das Dilemma des deutschen Kaiserreichs gewesen, sondern die Unfähigkeit des Regierungssystems, die vorhandenen Modernisierungstendenzen so zu kanalisieren, dass sie sich nicht destruktiv, sondern produktiv auswirkten.
Stärker auf die Schaffung von Handlungsspielräumen zielt der Beitrag von Ralf Regener. Er lenkt den Blick von Berlin und den Interaktionen mit den Reichinstitutionen auf die Provinz und die unmittelbare Kommunalpolitik. Am Beispiel von Magdeburg, der Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen, zeigt Regener, wie es den Sozialdemokraten gelang – trotz schwieriger Anfänge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und anhaltender Schikanen durch Behörden, Polizei, Justiz und Arbeitgeber –, vorhandene Handlungsspielräume des Obrigkeitsstaates zu nutzen. Wichtigster Schauplatz der Kommunalpolitik war die Stadtverordnetenversammlung. Vor allem aufgrund des Drei-Klassen-Wahlrechts gab es dort zwar nur eine kleine sozialdemokratische Fraktion. Nichtsdestotrotz konnten Anliegen wirksam artikuliert und Forderungen zum Teil auch durchgesetzt werden.
Kerstin Wolff sucht nach der Beteiligung von Frauen an der Politik im Kaiserreich. Dazu betrachtet sie unkonventionelle Formen der Beteiligung jenseits des Wahlrechts (welches den Frauen bis 1918 verwehrt blieb) und findet erfolgreiche politische Akteurinnen im Bereich der kommunalen Sozial- und Bildungspolitik. In der Kommune bewiesen die Frauen, dass sie in der Lage waren, auf konkrete Probleme erfolgreich mit öffentlich-privaten Partnerschaften zu reagieren. Für die Kommunen bewiesen Frauen sich auf diese Weise als verlässliche und gleichwertige Verhandlungspartner, förderten die Entwicklung eines belastungsfähigen Wohlfahrtsstaates und verhalfen dem Staat gleichzeitig zu einem starken Modernitätsschub.
4. Intellektuelle und religiöse Milieus
Nach der Auseinandersetzung mit der kommunalen Ebene beschäftigen sich die Beiträge damit, wie die Modernisierung und der Demokratisierungsdruck von unterschiedlichen intellektuellen und religiösen Gruppen wahrgenommen, erlebt und verarbeitet wurden. Die Abhandlung von Ulrich Sieg beginnt mit dem radikalen Konservatismus und fragt nach dessen Erfolgsbedingungen. Er entstand nach der Revolution von 1848, als sich Konservative den tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel und ihre eigene politische Erfolglosigkeit erklären mussten. Zu diesem Zweck rekurrierten Intellektuelle auf geschichtsphilosophische Denkfiguren, die eine bessere Zukunft nach dem Untergang einer maroden Gegenwart in Aussicht stellten. In der Folgezeit stilisierten sich Schlüsselfiguren dieser Weltsicht wie Paul de Lagarde, Julius Langbehn und Houston Stewart Chamberlain zu verfemten Außenseitern, konnten aber auf öffentliches Interesse und eine rasch wachsende Anhängerschaft bauen. Um 1900 waren ihre Ideen im deutschen Bürgertum wie unter den Verlierern der rasanten Modernisierung bereits mehrheitsfähig. Mit der Betrachtung der Ideologeme und rhetorischen Mittel zielt der Beitrag auf die Klärung der Frage, wie es gelingen konnte, ein im Kern apokalyptisches Denken als konservativ zu präsentieren.
Möchte man sich einer anderen Seite des politischen Spektrums widmen, so stellt Marcus Llanque fest: „Die Suche nach ‚demokratischen Intellektuellen‘ im Kaiserreich ist … schwieriger als man denken mag.“ Selbst unter demokratie-affinen Intellektuellen stellt er ein hohes Maß an Demokratie-Skepsis fest. Bei bürgerlichen Intellektuellen gründete sich diese Skepsis auf die Angst vor der „Masse“ und damit vor der Regierung durch einen „Demagogen“. Sozialistische Intellektuelle hätten ein deutlich positiveres Bild der Masse, insbesondere in Form der Masse der Arbeiter. Für sie sei Demokratie aber vor allem ein Mittel zum Zweck der Errichtung der sozialistischen Gesellschaft gewesen.
Tobias Hirschmüller beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Frage, wie liberale, orthodoxe und zionistische deutsche Juden an die Reichsgründung erinnerten. Auf der Quellengrundlage von jüdischen Wochen- und Monatsschriften untersucht er insbesondere die anlässlich von Jubiläen erschienenen Kommentare. Hirschmüller kommt dabei zum Ergebnis, dass eine Erinnerung an die Entstehung des Reiches meist in der liberalen jüdischen Presse praktiziert wurde. Bezugspunkte der Erinnerung waren zum einen die symbolische Gründung des Reiches am 18. Januar, da mit der deutschen Einigung für Juden die formale rechtliche Gleichstellung als Deutsche erreicht wurde. Zum anderen war die Erinnerung an die Schlacht von Sedan ein Fixpunkt, da hier auch die jüdischen deutschen Soldaten ihren Beitrag geleistet hatten und somit die erzielte Anerkennung von den Redaktionen als verdient kommuniziert wurde. Die Bezugnahmen auf die jüdischen Verdienste bei der „Reichsgründung“ waren gleichzeitig in entscheidendem Maße der Abwehr von steigendem Antisemitismus geschuldet.
Mit ähnlicher Stoßrichtung betrachtet Sabine Mangold-Will das Spannungsverhältnis zwischen Antisemitismus und Emanzipation. Antisemitismus war im Kaiserreich ein weit verbreitetes Phänomen. Aber genauso gilt: Das 1871 gegründete Deutsche Reich garantierte gesetzlich die „Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung“. Diese rechtliche Norm eröffnete in der Lebenspraxis der deutschen Juden zwischen 1871 und 1914 neue Möglichkeiten und bedeutete mithin auch mehr Freiheit – eine Freiheit, die gesellschaftlich immer wieder bestritten, aber rechtlich auf Reichsebene nicht zurückgenommen wurde.
5. Erinnerungskultur
In einem abschließenden Teil widmen sich die Beiträge der Wirkungsgeschichte des Kaiserreichs in der deutschen Geschichte und in der Erinnerungskultur.
Martin Sabrow fragt nach dem Verhältnis der Hohenzollern zur Demokratie. Er sieht in der Weimarer Republik die Entwicklung zweier gegeneinander laufender Linien: die zunehmende Integration der entmachteten Kaiserfamilie in die bürgerliche Gesellschaft und die Herausbildung eines monarchischen Gegenmilieus. Während der kulturelle Monarchismus eine breite Wirkung in der gesamten Zeit der Weimarer Republik entfalten konnte, blieb der Monarchismus als politische Bewegung doch schwach. Sabrow macht dafür mehrere Faktoren verantwortlich. Den relevanten Figuren fehlte einerseits die Statur, um das „politische und symbolische Vakuum“ zu füllen, welches der unrühmliche Sturz der Monarchie 1918 hinterlassen hatte. Andererseits waren auch die Versuche erfolglos, den Aufstieg der Nationalsozialisten für eine monarchische Restauration zu nutzen. Aufgrund ihrer Bereitschaft zum Bündnis mit den Nationalsozialisten habe die Kaiserfamilie jedoch eine große Mitverantwortung an der Zerstörung der Republik auf sich genommen.
Ulf Morgenstern widmet sich den kolonialen Ambitionen des Kaiserreichs und deren Langzeitwirkungen. Deutsche Reeder, Händler und Siedler waren lange schon global engagiert, bevor das Deutsche Kaiserreich spät in den Wettlauf um Kolonien eintrat. Der Versailler Vertrag beendete diese Epoche formell, doch Deutsche blieben auch weiterhin Teil des weltweiten kolonialen Projekts. Die daraus resultierenden ungleichen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie die oft übersehenen gesellschaftlichen und kulturellen Einschreibungen bewertet Morgenstern als Aufforderung zu einer Auseinandersetzung mit diesem Themenkreis. Historische Forschungen könne und solle dabei die Grundlage für die demokratischen Diskurse und Verhandlungen der Gegenwart liefern.
Das Kaiserreich wird gerne – mit einiger Berechtigung – mit Militarismus in Verbindung gebracht. Wie schlägt sich dieser Bezug in der Traditionspflege der Bundeswehr nieder? Florian Schreiner beginnt mit dem „Traditionserlass“ der Bundeswehr, in dem auf die vielfältigen Brüche und Zäsuren in der militärischen Tradition verwiesen wird und aus der alle Teile ausgeschlossen werden, „die unvereinbar mit den Werten unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind.“ Gleichwohl diagnostiziert Schreiner – neben vielen organisatorischen Veränderungen vor allem in der Befehlsstruktur – zahlreiche Anknüpfungspunkte an die militärische Tradition des Kaiserreichs – oftmals begleitet von einem Bedeutungswandel –, von Kasernennamen, Uniformen und Liedgutpflege bis zu den Leitlinien der Inneren Führung der Streitkräfte. Daher sieht Schreiner „im Umgang des Deutschen Militärs mit dem Kaiserreich … eine Koexistenz von drei zentralen Merkmalen: Kontinuität, Zäsur und Transformation, die einem stetigen Aushandlungsprozess im Spannungsfeld von Politik, Militär und Gesellschaft unterliegen.“
Die engen Verflechtungen von Krieg und Nation untersucht die Ausstellung „KRIEG MACHT NATION“ des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr, die Katja Protte vorstellt. Das Konzept von Nation und Nationalstaat steht heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Sehnsucht nach Heimat und regionaler Identität. Das Militärhistorische Museum hat daher die 150jährige Wiederkehr des Deutsch-Französischen Krieges und der Gründung des deutschen Kaiserreichs zum Anlass genommen, ein Thema aufzugreifen, dem sich lange Zeit kein großes Ausstellungsprojekt mehr gewidmet hat: der kriegerischen Gründung des ersten deutschen Nationalstaats. Die Ausstellung zeigt die fast vergessenen Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 als Kulminationspunkte von Fortschrittsglauben und Nationalidee im 19. Jahrhundert, die unsere Vorstellung von Krieg und Nationalstaat bis heute weit mehr prägen, als vielen Menschen bewusst ist. Sie ermutigt Besucherinnern und Besucher, genauer hinzuschauen, anstatt das Kaiserreich und seine Vorgeschichte entweder als „gute alte Zeit“ zu verklären oder als Wurzel allen Übels in der deutschen Geschichte zu verdammen.
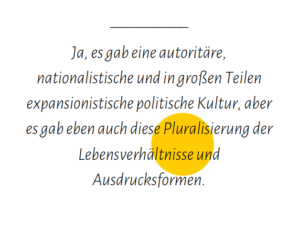
In einer kritischen Auseinandersetzung mit jüngst publizierten Urteilen über den angeblich rein obrigkeitsstaatlichen, antidemokratischen und bellizistischen Charakter des deutschen Kaiserreichs beleuchtet der abschließende Beitrag von Ulrich Lappenküper den facettenreichen politisch-gesellschaftlichen Diskurs der Deutschen über Reich und Reichsgründung und schlägt dabei den zeitlichen Bogen von 1871 bis in die Gegenwart. Vor dem Hintergrund der neuen Forschungen sieht Lappenküper das Kaiserreich als die wohl einzig realistische Antwort auf die seit Generationen schwelende deutsche Frage wie auch als eine wichtige Etappe auf dem verschlungenen Weg Deutschlands zur Demokratie. Er plädiert daher dafür, den 150. Jahrestag der Reichsgründung intensiv dafür zu nutzen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit über eine wesentliche Epoche deutscher Geschichte zu schärfen und dieser Epoche einen Platz im Demokratiegedächtnis der Bundesrepublik nicht zu versagen.
Fazit: Demokratisierung ohne Demokratie
Doch was steht diesem Kaiserreich nun an angemessener Erinnerung zu? Die Antwort darauf fällt nicht leicht. Zweifelsohne bildeten die Jahrzehnte des Kaiserreichs die Phase des Durchbruchs der „klassischen Moderne“. Der Historiker Detlef Peukert charakterisierte sie so: „In ihr entstanden die Züge unserer gegenwärtigen Lebenswelt, erfolgte der Durchbruch der modernen Sozialpolitik, Technik, Naturwissenschaft, der Humanwissenschaften und der modernen Kunst, Musik, Architektur und Literatur.“ Aber erfolgte auch der Durchbruch der modernen Demokratie? In verfassungsrechtlicher und politischer Hinsicht muss man klar feststellen: nein. Das politische System des Kaiserreichs war auf die Verhinderung von formeller Demokratisierung ausgelegt und erbrachte diese „Leistung“ bis zum Schluss. Hinzu kam, dass die Fürsten am monarchischen Prinzip, dem Gottesgnadentum und der fürstlichen Souveränität im Gegensatz zur Volkssouveränität bis zum Schluss als Herrschaftsdoktrin festhielten. Auch dies stand einer verfassungsrechtlichen Demokratisierung bis zu den Oktoberreformen 1918 im Weg und wurde im November 1918 durch die Revolution hinweggefegt. Erst dann war der Weg zu einer modernen parlamentarischen Demokratie frei.
Gleichwohl sind in der politischen und gesellschaftlichen Praxis des Kaiserreichs klare Tendenzen hin zu einer Demokratisierung zu diagnostizieren. Der Reichstag gewann kontinuierlich an Einfluss, das moderne Parteiensystem entstand, in den Kommunen und einzelnen Gliedstaaten wurden verschiedenste demokratische Handlungsformen erprobt, der Föderalismus und die komplizierte Verfassungsarchitektur zwangen zu Kooperation statt obrigkeitsstaatlichem Durchregieren. Die Gesellschaft des Kaiserreichs war hochgradig pluralistisch und pflegte verschiedenste Ausdrucksformen. Gesellschaftlich und politisch ausgeschlossene Gruppen wie Sozialdemokraten, Frauen und Deutsche jüdischen Glaubens identifizierten und nutzten Spielräume für ihre unterschiedlichen „Kämpfe um Anerkennung“. Ja, es gab eine autoritäre, nationalistische und in großen Teilen expansionistische politische Kultur, aber es gab eben auch diese Pluralisierung der Lebensverhältnisse und Ausdrucksformen. In gesellschaftlicher Hinsicht kann man demnach Elemente der Demokratisierung erkennen, nur trafen sie auf ein politisches und intellektuelles Establishment und auf ein Verfassungsgefüge, das diese als Anmaßung, Zumutung und existentielle Herausforderung wahrnahm und eher abzuwehren als zu integrieren versuchte.
