Das deutsche Kolonialreich nach 1918: Trauma, Glorifizierung, Vergessen und spätes Erinnern
Ulf Morgenstern
Wer von Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert spricht, darf über die Kolonialgeschichte nicht schweigen. So kann eine Erkenntnis lauten, zu der man seit einigen Jahren nach dem Blick in die Feuilletons und in einen wachsenden Teil der historischen Fachliteratur kommen kann. Was ist daran neu?
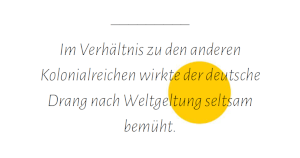
Lange Zeit gehörte das globale Wirtschaften von deutschen Unternehmern und die diesen Verflechtungen folgende überseeische Expansion des Kaiserreichs nur als Fußnote zu den um den ersten deutschen Nationalstaat gestrickten Narrativen. In unterschiedlicher Gewichtung dominierten dabei vielmehr die Schlagworte von nationaler Einigung, beginnender Parlamentarisierung, Rechts- und/oder Obrigkeitsstaat, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Dynamik, Klassengesellschaft und Minderheitenunterdrückung, Föderalismus und Mobilität, Emanzipation und Reformpädagogik, Militarismus und Medienmacht, Chauvinismus und jähem Ende nach der Kriegsniederlage im November 1918.
Zu diesen um die innere Entwicklung Deutschlands kreisenden Themen kam im Rückblick auf die deutsche Außen- sprich: europäische Bündnispolitik auch das mit Bernhard Bülows Forderung nach einem „Platz an der Sonne“ und der Hunnenrede Wilhelms II. verbundene Feld des Hochimperialismus und einer aggressiven Weltpolitik.
Im Verhältnis zu den Kolonialreichen Großbritanniens und Frankreichs, aber auch denen der Niederlande und Belgiens oder den alten Imperien Spaniens oder Portugals wirkte der deutsche Drang nach Weltgeltung allerdings seltsam bemüht. Die zunächst Schutzgebiete genannten Kolonien lagen über den Globus verstreut, hatten eher überschaubaren Umfang und waren von 1884 bis 1914/18 auch nur während dreier Jahrzehnte im Besitz des Deutschen Reichs. Man konnte beim Gang durch das an Katastrophen reiche 20. Jahrhundert tatsächlich zu dem Eindruck kommen, als ob Bismarcks kategorische Antwort an einen um mehr Engagement im nordafrikanischen Grenzgebiet zwischen französischen und britischen Einflusssphären bittenden Kolonialenthusiasten der Wahrheit entsprochen und danach Geltung behalten hätte:
„Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Rußland, und hier – nach links deutend – liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte, das ist meine Karte von Afrika.“
Diese Deutung der im Wesentlichen auf die Jahre 1884/85 begrenzten, aktiven Bismarckschen Kolonialpolitik setzte sich aus unterschiedlichen Gründen in der kollektiven Erinnerung der Deutschen durch. Aber sie stimmte im Grunde weder an jenem frostkalten 5. Dezember 1888, als Bismarck sie in Betonung der Bedeutung der europäischen Diplomatie gegenüber dem weltreisenden Journalisten Eugen Wolf bei einer Kutschfahrt im norddeutschen Schnee formulierte, noch in den Jahren nach seiner Regierungszeit. Bereits als Gastgeber der Berliner Afrika-Konferenz hatte Bismarck 1884/85 nicht unerheblichen Einfluss auf die Verteilung von Interessensphären der Kolonialmächte genommen, und auch in seinen verbleibenden Regierungsjahren blieb er dauerhaft mit kolonialpolitischen Themen befasst, die sich vielfach nicht mehr von der europäischen Außenpolitik klassischen Stils trennen ließen.
Das galt noch mehr für die Nachfolger Bismarcks – zu denken ist etwa an den mühelos die Kontinente überwindenden „Tausch“ Sansibars gegen Helgoland im Juli 1890. Neben überseeischen Gebietserweiterungen, blutigen Kolonialkriegen mit Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und einer aberwitzigen Verlängerung der Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs von Europa nach Ostafrika war das Deutsche Reich in fast jede Facette des gemeinsamen kolonialen Projekts des Westens verstrickt (wobei der ältere Binnenkolonialismus des Osmanischen Reiches sowie der jüngere in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch der des Zarenreichs nicht vergessen werden sollte). Allerdings war das Kaiserreich formell ein Latecomer. Die lautstarke Kolonialpropaganda von Lobbyverbänden schaffte es nicht, die gewünschten Siedlerströme nach Deutsch-Ostafrika, Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika oder an die asiatischen Spots zu locken – die Auswanderung kannte fast nur die Richtung über den Atlantik in die USA oder in die Nationalstaaten Südamerikas. Das lag auch daran, dass das Reich trotz stetig wachsender Kosten noch immer weniger in koloniale Infrastruktur investierte, als mancher Enthusiast es sich erträumte. Die deutschen Kolonien blieben als Projektionsflächen der imperialistisch gestimmten Metropolen daher vor allem „Phantasiereiche“ (Birthe Kundrus), allein das kleine Togo war am Ende kein Zuschussgeschäft mehr.
Dennoch sollte die tatsächliche Bedeutung der deutschen Kolonien nicht unterschätzt werden, die jeweiligen eingeborenen Bevölkerungsschichten konnten im Alltag als Bürger zweiter Klasse oder als Objekt moderner Kriegsführung ein Lied davon singen. Die Deutschen hatten sich binnen weniger Jahre bereitwillig an der „Unterwerfung der Welt“ (Wolfgang Reinhard) beteiligt, und sie hofften in den Friedensjahren des Kaiserreichs – bis auf wenige sozialdemokratische oder linksliberale Gegner – auf ein stetiges Wachstum bei Landesausbau, Zivilisationsmission und diesbezüglichem Prestige im Kreis der etablierten Imperialmächte. Einige Unternehmer machten über Jahrzehnte erkleckliche Gewinne, zu denken ist etwa an Hamburger und Bremer Reedereien oder an Baukonzerne, die Aufträge für Häfen, Straßen und Eisenbahnen verbuchten.
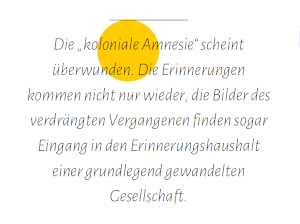
Was noch wichtiger war als der Wunsch nach Prosperität der deutschen Überseeterritorien als Absatzmärkte und Rohstofflieferanten war die chronologische und geografische Überschreitung dieses Rahmens. Deutsche hatten nicht nur lange vor 1884 in Übersee gelebt und Waren und Rohstoffe von dort nach Europa, Amerika und Asien im- und von dort exportiert. Sie taten es auch nach der Abtretung der deutschen Kolonien im Versailler Vertrag. Geografisch waren den Ansiedlungsideen von deutschen Auswanderern und den Aktivitäten deutscher Unternehmer, Missionare und Forschungsreisender kaum Grenzen gesetzt – ob in den Kolonien anderer Mächte oder in völkerrechtlich anerkannten Staaten, überall finden sich deutsche Handelsniederlassungen und Siedlungen, gern „Colonien“ genannt. Diese kulturelle und sprachliche Vielfalt an der Frontier endete erst, als im Zuge des Ersten Weltkriegs in den Kolonialgebieten der Alliierten deutsche Ortsnamen verschwanden, Schulen geschlossen wurden und die deutschen Communities zur Assimilation oder erneuten Auswanderung gezwungen wurden.
Man muss sich den vielfältigen Austausch und das globale Grundrauschen vorstellen, um zu verstehen, welchen Schock das Ende des Kolonialreichs auslöste, als die Siegermächte dem Deutschen Reich 1919 die Unfähigkeit als Kolonialmacht ins Stammbuch schrieben. Im Versailler Vertrag wurde zwar nur die Alleinschuld des Deutschen Reichs am Kriegsausbruch und das Abtreten seiner afrikanischen und asiatischen Kolonien festgeschrieben, aber auch die Feststellung des deutschen Scheiterns als Kolonialmacht fand über die empörte politische Publizistik den Weg in die Köpfe – in denen sie sich als Legende von der Anmaßung der Pariser und Londoner Kolonialherren festsetzte. Der Kolonialrevisionismus der Zwischenkriegszeit und die mythisierenden Redensarten von treuen Askaris, die auch noch in der Bundesrepublik im Umlauf waren, verfestigten dieses Zerrbild eines „sauberen“ deutschen Kolonialismus.
Historiker mit Schwerpunkten in der Global-, Imperial-, Kolonial- und Genozidgeschichte beklagen längst die unkritische Haltung ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger etwa bei der Namibia-Nostalgie im Reisebüro oder dem Kitsch des Kolonialretrostils in Möbelhäusern des mittleren Preissegments. Allerdings blieben diese Monita in Deutschland bislang auf den akademischen Elfenbeinturm beschränkt.
Diese Wirkungseinschränkung wissenschaftlicher Erkenntnis in der Öffentlichkeit gilt auch für Forschungen über den Kolonialismus der Zwischenkriegszeit. Inzwischen ist in einer Reihe von Studien nachgewiesen, dass nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches und der damit einhergehenden nochmaligen Ausdehnung britischer und französischer Einfluss- und Herrschaftsgebiete nicht nur der koloniale Machtanspruch des weißen Europas erst zwischen den beiden Weltkriegen seinen Höhepunkt erreichte, sondern dass auch der diesbezügliche Phantomschmerz bei den Deutschen erst in den Jahren der Weimarer Republik und des Dritten Reiches auf einen solchen zusteuerte. Der Kolonialrevisionismus entzündete sich im rhetorischen Umfeld der „Kriegsschuldlüge“ und der „Dolchstoßlegende“ besonders an den die Abtretung der deutschen Kolonien behandelnden Artikeln 118 bis 158 des Versailler Vertrags. Er verlor trotz steigender Mitgliederzahlen einschlägiger Vereine mit den Jahren jene Züge ostentativer Zurückweisung, die er in den frühen 1920er Jahren gehabt hatte. Der Verlust war weniger akut als kurz nach dem verlorenen Krieg und wurde als Gegenstand einer breiten kolonialrevisionistischen Publizistik wie auch als Teil eines umfassenderen Revisionismus ins Allgemeine gekehrt.
Indirekt schwangen Motive überseeischer Herrschaft und Siedlung auch in der NS-Propaganda weiterhin mit. Das Regime benutzte revisionistische Grundstimmungen und band sie etwa in Form des seit 1936 alle eigenständigen Verbände zusammenführenden Reichskolonialbundes in die eigene Politik ein. Formelle Selbstständigkeit erkaufte sich dieser Dachverband durch bedingungslose Unterordnung unter die Vorgaben der NS-Propaganda – und -politik. Als diese nach dem Überfall auf die Sowjetunion ganz andere Kolonialpläne umzusetzen begann, wurde der mehr als zwei Millionen Mitglieder zählende Reichskolonialbund im Februar 1943 sang- und klanglos aufgelöst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich ein widersprüchliches Bild. Einerseits wandte sich die Mehrheit der Deutschen mit zunehmendem Desinteresse von der Kolonialgeschichte ab, die in Form von Denkmälern, Straßennamen im öffentlichen Raum gleichsam ein folkloristischer Bestandteil des Ehrregimes der Nation wurde. Einige „alte Afrikaner“ bemächtigten sich hingegen erneut des Themas und griffen im Kontrast zu den Verbrechen des Dritten Reiches den Mythos von der vermeintlich sauberen deutschen Kolonialgeschichte wieder auf. Afrika-Veteranen genossen in diesen Kreisen hohes Ansehen und noch 1955 wurde ein in der NS-Zeit für das Düsseldorfer Rheinufer geplantes Denkmal zu Ehren Paul von Lettow-Vorbecks im östlich von Hamburg gelegenen Aumühle eingeweiht – mit dem in Deutsch-Ostafrika geborenen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Kai-Uwe von Hassel als Festredner.
Danach wurde es nach und nach ruhiger um das Thema. Im Zentrum der kanonisierten Gewissheiten der deutschen Geschichte stehen seit den ausgehenden 1960er-Jahren die Verbrechen des „Dritten Reichs“. Daran schließt sich heute das Wissen um die zögerliche Distanzierung sowie späte und mühsame Aufarbeitung an. Bis in die Gegenwart sind Nationalsozialismus und Holocaust ein ständiges Diskursthema. Historische Forschungen und Debatten haben nicht unmaßgeblich zu einer Sensibilisierung in einem breiten öffentlichen Bewusstsein beigetragen. Allerdings beklagen einige Historiker, dass eine zu ausschließliche Fokussierung auf „die besagten 12 Jahre“ (Theodor Heuss) den Blick auf andere Epochen und Themen zu verstellen drohe, und zwar auf solche mit positiver Konnotation (deutsche Demokratiegeschichte seit 1848) wie solche mit negativer wie die seit 1990 intensiv erforschte SED-Diktatur.
Daneben beansprucht seit den 2000er-Jahren die Globalgeschichte Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg einen zusehends größeren Raum. Das deutsche Kaiserreich und seine staatlichen Vorläufer wurden und werden von ihr, wenn auch nicht voraussetzungslos und wertfrei, anders als in den ideologisch aufgeladenen Sonderwegthesen als historisch eigenständige Lemmata im Wörterbuch der deutschen Geschichte betrachtet und nicht mehr auf eine Vorgeschichte des „Dritten Reichs“ reduziert. Aber auch eine entwicklungsoffene Beschäftigung mit der Zeit des Hochimperialismus kommt an dessen unstrittigen Schattenseiten nicht vorbei. Dazu zählt neben den eklatant ungleichen wirtschaftlichen Hierarchien zwischen Europa und dem globalen Süden auch der formelle Kolonialismus. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters, stellte bei der Eröffnung eines Symposiums im Deutschen Historischen Museum am 7. Juni 2018 indikativisch fest: „Viel zu lange war die Kolonialzeit ein blinder Fleck in der deutschen Erinnerungskultur.“
Das ändert sich gegenwärtig erkennbar durch die aller Orten einziehende Provenienzforschung für koloniales Raubgut in Museen, die Einrichtung von Forschungsstellen für (post-)koloniale Geschichtsforschung und etwa den breiten Diskurs über die Ausgestaltung des Berliner Humboldt-Forums. Unkommentierte Straßennamen und Denkmäler, die an Helden nach den Maßstäben der Epoche der weißen Überlegenheit erinnern, empören heute insbesondere Vertreter von zivilgesellschaftlichen Interessengruppen, etwa afrikanisch-stämmige Deutsche. Dass aus diesem Diskursumfeld Forderungen erhoben werden, wonach Begriffe wie Afrikareisender, Entdecker und Missionar in Anführungsstriche gesetzt werden sollten, zeigt, welche Befindlichkeiten in den Einwanderungsgesellschaften und akademischen Milieus der Großstädte abseits der deutschen Mehrheitswahrnehmung existieren.
Die damit verbundenen Aufgeregtheiten sollten einer sachlichen, demokratisch verhandelten Auseinandersetzung weichen. Um bei einer medizinischen Metapher von Jürgen Zimmerer anzuknüpfen: Die „koloniale Amnesie“ scheint überwunden. Die Erinnerungen kommen nicht nur wieder, die Bilder des verdrängten Vergangenen finden sogar Eingang in den Erinnerungshaushalt einer grundlegend gewandelten Gesellschaft. Man sollte freilich aufpassen, dass aus dem gelegentlich erhöhten Ruhepuls keine Neurasthenie wird, jener nervöse Epochengrundzug des in seinen Maßlosigkeiten zu Recht inkriminierten Zeitalters des Hochimperialismus. Schließlich verhandelt die Kolonialgeschichte nichts weniger als die Geschichte der Gegenwart, die unzweifelhaft eine Geschichte der Globalisierung ist.
Literatur
Gründer, Horst, Geschichte der deutschen Kolonien, 7. Aufl., Paderborn
2018
Kundrus, Birthe, Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im
Spiegel seiner Kolonien, Köln 2003
Reinhard, Wolfgang, Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte
der europäischen Expansion 1415–2015, München 2016
van der Heyden, Ulrich/Zeller, Joachim (Hg.), Kolonialismus
hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2007
Zimmerer, Jürgen (Hg.), Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte
der deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt a.M. 2013
