Politischer Katholizismus und Demokratisierung im Kaiserreich
Stefan Gerber
Der politische Katholizismus in Deutschland entfaltete sich seit den 1830er Jahren aus der Defensive: Mit der Säkularisation und der Auflösung des Alten Reiches waren die Grundlagen der Reichskirche zerstört worden. An die Stelle des bisherigen Systems war in den Staaten des Rheinbundes und des Deutschen Bundes eine von Aufklärung und bürokratischem Etatismus geprägte Staatskirchenpolitik getreten. Diese fasste die innere Autonomie der katholischen Kirche in Deutschland und ihre Bindung an das Papsttum, die sich nach dem Ende der Reichskirche wieder festigte, als Bedrohung und Hindernis beim Aufbau moderner Staatlichkeit auf. Aus dieser wachsenden Spannung resultierten in verschiedenen deutschen Staaten schon in der Vormärzzeit schwerwiegende Konflikte im Überschneidungs- und Konkurrenzbereich von Staat und Kirche (z. B. der preußische „Mischehenstreit“ und das „Kölner Ereignis“ 1838). Sie wurden zu einem wirkmächtigen Mobilisierungsimpuls für die „katholische Bewegung“. Zugleich machten sie früh deutlich, was den politischen Katholizismus in Deutschland bis zu seinem Ende 1933 als ein wesentlicher Grundzug prägen sollte: Da die Verwirklichung kirchlicher und religiöser Freiheit im Staat nach 1815 nur noch im Rahmen konstitutioneller Grundrechtssicherung denkbar und möglich war, konstituierte sich der politische Katholizismus von Beginn an als „Verfassungspartei“.
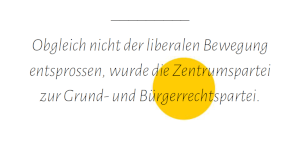
Unter diesem Namen fanden sich im Dezember 1870 katholische Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses zu einer Fraktion zusammen. Grundlage war ein aus Diskussionen seit der Mitte der 1860er Jahre erwachsenes knappes Parteiprogramm vom Oktober 1870, das als „Soester Programm“ fast bis zum Ende des Kaiserreichs in Geltung bleiben sollte. Nach der ersten Reichstagwahl entstand im März 1871 auch eine Reichstagfraktion des „Zentrums“. Diese Bezeichnung hatte sich 1859 schon die seit 1852 bestehende, kurzlebige katholische Fraktion im preußischen Landtag gegeben und damit eine Mittelstellung zwischen Liberalismus und Konservatismus reklamiert. Ziel der Gründung war keine katholische Interessenpartei, sondern eine „Volkspartei“ auf breiter sozialer Grundlage. Föderalistisch und trotz der Anerkennung des kleindeutschen Nationalstaates in großdeutscher Tradition stehend, legte das Zentrum den politischen Schwerpunkt auf die grundrechtliche Absicherung religiöser Freiheit und kirchlicher Rechte (insbesondere die konfessionelle Schule), auf sozialen Ausgleich und eine christlich fundierte Gesellschaftspolitik. Obgleich nicht der liberalen Bewegung entsprossen, wurde die Partei damit zur Grund- und Bürgerrechtspartei. Sie machte das bereits in den ersten Wochen des neuen Reichstages durch den Antrag deutlich, Grundrechte (Meinungsfreiheit, Zensurverbot, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Religions- und Kirchenfreiheit) in die Bismarcksche Reichsverfassung aufzunehmen.
Der im April 1871 mit großer Mehrheit abgelehnte „Grundrechtsantrag“ markierte einen programmatischen, auf den freiheitlich-rechtsstaatlichen Ausbau des politischen Systems im Kaiserreich zielenden Kern der Zentrumspolitik. Das galt umso mehr, als der politische Katholizismus bald nach der Reichs
gründung unter massiven Druck geriet. Der von Reichskanzler Otto von Bismarck im Bündnis vor allem mit dem Nationalliberalismus entfesselte „Kulturkampf“ zielte auf die Zurückdrängung der katholischen Kirche aus dem öffentlichen Leben. Der deutsche Katholizismus wurde als eine „anti-nationale“, von „fremden“ Potentaten (dem Papst und der katholischen Weltkirche) abhängige Macht denunziert. Das staatliche Vorgehen gegen katholische Geistliche, Orden und Seelsorge führte zu teilweise massiven Einschränkungen von Bürgerrechten und -freiheiten (Kulturkampfgesetzgebung 1871-1875), denen sich das Zentrum vehement entgegenstellte. Das Bestreben der Partei, sich zur überkonfessionellen „Volkspartei“ weiterzuentwickeln, wurde durch diese neuerliche katholische Defensive, die die Mentalität der deutschen Katholiken bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägen sollte, zwar zurückgeworfen. Zugleich konnte das Zentrum sich aber noch schärfer als zuvor als eine Partei der konstitutionellen Rechtssicherung profilieren, von der nicht nur die katholischen Deutschen, sondern alle Angehörigen des neuen kleindeutschen Reichs profitieren mussten. Der „Kulturkampf“ führte somit nicht nur – ganz entgegen den Intentionen Bismarcks – zu einer Konsolidierung und Stärkung der Partei des politischen Katholizismus, die bei den Reichstagwahlen 1881 eindrucksvoll demonstrierte, wie weitgehend sie das katholische Deutschland unter dem Außendruck des Kulturkampfes politisch integrieren konnte: 86,3 Prozent der Wähler katholischer Konfession gaben ihre Stimme für das Zentrum ab, das mit 100 Mandaten erstmals stärkste Partei im Reichstag wurde. Der Konflikt machte dem deutschen Katholizismus, seiner Partei und der ganzen deutschen Öffentlichkeit darüber hinaus auch deutlich, dass der konstitutionelle Parlamentarismus des Kaiserreichs ungeachtet des Fehlens einer dem Reichstag verantwortlichen Regierung eine Plattform bot, der Politik des Reichskanzlers wirksam entgegenzutreten und damit sukzessive auch das System selbst zu verändern.
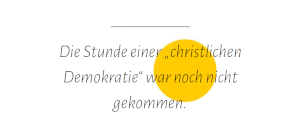
Zudem bewirkte der Kulturkampf im katholischen Segment der deutschen Gesellschaft eine Fundamentalpolitisierung und politische Mobilisierung. Sie betraf nicht nur die über 25-jährigen Männer, die nach dem für den Reichstag geltenden allgemein und gleichen Wahlrecht die Möglichkeit politischer Mitbestimmung besaßen. Das Zentrum mobilisierte im Kulturkampf auch in bisher ungekanntem Ausmaß katholische Frauen, die in verschiedensten Aktionsformen, bis hin zu Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, passivem und auch aktivem Widerstand gegen Kulturkampfmaßnahmen (besonders im Schulbereich) die Arbeit des politischen Katholizismus unterstützten. Noch vor der flächendeckenden Bildung gesellschaftspolitisch ausgerichteter katholischer Frauenvereine, die über die tradierten caritativen Frauenvereinigungen hinausgriffen, begann die Zentrumspartei, Frauen direkt in die Wahlkampfarbeit einzubinden und zu politischen Versammlungen einzuladen, obwohl dies bis 1908 nicht erlaubt war. Im November 1905 war es der Vorsitzende der Zentrumsfraktion Alfred Graf von Hompesch, der im Reichstag mit anderen Zentrumsabgeordneten den Antrag stellte, Frauen die Teilnahme an „sozialpolitischen“ Vereinen und Versammlungen zu gestatten. Im bayerischen Landtag unterstützte 1905 eine ganze Reihe von katholischen Abgeordneten eine Petition auf Einführung des Frauenwahlrechts, obwohl dieses weder auf der Agenda des Zentrums noch der katholischen Frauenbewegung ganz oben rangierte. In Preußen hatte das Zentrum schon 1876 einen Vorstoß unterstützt, finanziell unabhängigen geschäftstreibenden Frauen das Gemeindewahlrecht zu gewähren. Die weitreichende Politisierung und Mobilisierung, die das Zentrum im Kulturkampf vorantrieb, machen deutlich, dass diesem Konflikt ein nicht unbedeutender Platz in der Demokratisierungsgeschichte des Kaiserreichs zukommt.
Zu dem von der Parlamentarismusforschung konstatierten „Einflussgewinn“ des Reichstages im politischen Gefüge des Kaiserreichs hat der politische Katholizismus durch eine rege parlamentarische Arbeit beigetragen. Ludwig Windthorst, die bis zu seinem Tod 1891 dominierende Führungsfigur des politischen Katholizismus, war im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus über Jahrzehnte geradezu eine Verkörperung der politischen Lebensform des Parlamentariers. Die Reichstagsfraktion blieb auch nach der späten Konstituierung eines „Reichsausschusses“ des Zentrums als gesamtdeutsches Führungsgremium im Februar 1914 das unbestrittene Kraftzentrum der Partei. Entschieden trat das Zentrum denn auch in allen Wahlkämpfen des Kaiserreichs für die Erhaltung des allgemeinen und gleichen Reichstagswahlrechts ein und unternahm immer wieder Versuche, dieses Wahlrecht auch in den Bundesstaaten durchzusetzen. Schon 1873 beantragte Windthorst im preußischen Landtag die Ersetzung des Dreiklassenwahlrechts durch ein allgemeines und gleiches Wahlrecht.
Die Motive für diese Forderung, deren bis 1918 hinausgezögerte Umsetzung faktisch einen wirkungsvollen Demokratisierungsschritt bedeutet hätte, machte indes deutlich, wie spannungsvoll sich im Zentrum christliche, katholisch-konfessionelle, konservative und liberale Elemente verbanden. Denn ganz offen sprach Windthorst 1873 aus, dass der Beweggrund für seinen Antrag derselbe war, der auch Bismarck zur Gewährung des demokratischen Reichstagswahlrechts geführt hatte: Er erhoffte sich von der Masse der bäuerlichen, unter- und kleinbürgerlichen Wähler eine deutlich stärker konservative Wahlentscheidung als bei den sogenannten „oberen Klassen“.
Tatsächlich war die Partei des politischen Katholizismus sozial so heterogen wie keine andere deutsche Partei. Den auf der Führungsebene von Fraktion und Partei stark präsenten Vertretern des rheinischen, westfälischen, schlesischen und süddeutschen Adels standen Industrielle aus der Rheinprovinz und Schlesien, ein breites Feld bürgerlicher katholischer Mittelschichten und die wachsende Zahl katholischer Arbeiter gegenüber. Gerade in der Arbeiterschaft des rheinisch-westfälischen Industriegebietes konnte sich das Zentrum, je mehr die Sozialdemokratie nach 1890 an Boden gewann, nur mit Mühe behaupten. Es gelang durch die 1890 begründete erste katholische Massenorganisation, den „Volksverein für das katholische Deutschland“, durch die katholischen Arbeitervereine mit ihren sozialpolitisch wirkenden Pfarrern und Kaplänen, durch die Mobilisierung für das Zentrum auf den Katholikentagen und durch eine parlamentarisch kontinuierlich betriebene Sozial- und Arbeiterschutzpolitik. Für sie bildete der von dem Zentrumsabgeordneten Ferdinand Heribert Graf von Galen 1877 in den Reichstag eingebrachte erste umfassende Arbeiterschutzantrag den Auftakt.
In der Sozialpolitik wie auch in der Schutzzollpolitik, die das Zentrum nach dem Ende des Kulturkampfes und der „konservativen Wende“ Bismarcks unterstützte, zeigte sich die Ambivalenz, welche die Partei auch in ihrer politischen Kommunikation prägte – eine Ambivalenz, die von den einen als Vermittlungs- und Kompromissfähigkeit bewundert, von den anderen schon seit Windthorsts Tagen als „Eiertanz“ verhöhnt wurde. Den Konservativen in der Partei waren staatliche Sozialpolitik und Protektionismus als Ausdruck gesellschaftsstabilisierender, sozialkonservativ-patriarchaler Daseinsvorsorge zu vermitteln, dem Arbeiterflügel als Instrumente eines sozialreformistischen Systemumbaus. Forderungen nach erweiterter politischer Partizipation und Parlamentarisierung wurden durch das noch in den „Leitsätzen“ der Partei vom 30. Juni 1918 eindeutige Bekenntnis zu einer „starken Monarchie“ ausgeglichen. Die nach 1890 verlässliche Unterstützung des Zentrums für die finanziell ausgreifende und unitarisch wirkende Flotten- und Rüstungspolitik im Zeichen der „Weltpolitik“ wurde durch die von der Partei durchgesetzte föderale Finanzgesetzgebung und durch Kritik an der deutschen Kolonialverwaltung konterkariert. Sie führte 1907 zu einer Reichstagswahl („Hottentottenwahlen“), die ein letztes Mal von Blockbildung gegen Zentrum und Sozialdemokratie bestimmt war.
Unverkennbar verlor die Partei im späten Kaiserreich dennoch an politischer Integrationskraft. 1912 wählten nur noch ca. 60 Prozent der katholischen Wähler das Zentrum, das aufgrund des Mehrheitswahlrechts seine Mandatszahl aber im Wesentlichen behaupten konnte. Ungeachtet solcher Erosionserscheinungen konnte das Zentrum den Spagat zwischen Demokratisierungsforderungen, Sozialkonservatismus und „nationaler Politik“ im Wilhelminismus nicht zuletzt deshalb aushalten, weil der auch im späten Kaiserreich noch virulente Antikatholizismus als Integrationsklammer wirkte. Zugleich grenzte sich die Partei deutlich von der Zumutung direkter kirchlicher Handlungsanweisungen ab. Im Zentrums- und Gewerkschaftsstreit des frühen 20. Jahrhunderts setzte sich gegen die integralistische Richtung die Auffassung durch, dass das Zentrum auch in Zukunft programmatisch keine „katholische“, sondern eine politische Volkspartei auf christlicher Grundlage sein solle. Mit der Beteiligung an der Friedensresolution des Reichstages 1917 und der entscheidenden Rolle, die das Zentrum im „Interfraktionellen Ausschuss“ spielte, signalisierte die Partei des politischen Katholizismus, dass sie bereit war, in einer parlamentarischen Monarchie entscheidende politische Verantwortung zu übernehmen. Eine deutsche Republik lag bis in den November 1918 hinein nicht im politischen Horizont der Zentrumspartei.
Auch das politische Fahnenwort der „Demokratie“ lehnte die Partei ab. Papst Leo XIII. hatte zwar im Zuge der „Raillement“-Politik gegenüber dem laizistischen Frankreich auch die Republik zu einer für Katholiken akzeptablen Staatsform erklärt. Die „christliche Demokratie“ aber wollte dieser für das 20. Jahrhundert bahnbrechende päpstliche Soziallehrer in seiner Enzyklika „Graves de communi“ von 1901 auf sozialcaritative Aktivitäten beschränkt wissen. Das Zentrum vermied daher den Terminus, der zudem mit dem Ruch des Revolutionären und dem Beigeschmack Rousseauscher Volkssouveränitätstheorie umgeben war. Die Stunde einer „christlichen Demokratie“, die nach Hans Maiers Definition die Demokratie im Unterschied zum „politischen Katholizismus“ als ein „Faktum von providentieller Bedeutung“ sieht, war noch nicht gekommen. Unübersehbar aber ist, dass das Zentrum als Verfassungspartei, durch seine breite Mobilisierung im Kulturkampf, als Wahlrechts- und Sozialstaatspartei und durch seine außerordentliche politische Integrationsfähigkeit Entscheidendes zur Demokratisierung des Kaiserreichs beigetragen hat.
Literatur:
Anderson, Margaret Lavinia, Windthorst. Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks, Düsseldorf 1988
Anderson, Margaret Lavinia, Lehrjahre der Demokratie. Wahlen und politische Kultur im Deutschen Kaiserreich, Stuttgart 2009
Bachem, Karl, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Bewegung sowie zur allgemeinen Geschichte des neueren und neuesten Deutschlands 1815–1914, 9 Bde.,
Köln 1927–1932
Becker, Winfried (Hg.), Die Minderheit als Mitte. Die Deutsche Zentrumspartei in der Innenpolitik des Reiches 1871–1933,
Paderborn 1986
Bredohl, Thomas M., Class and religious identity. The Rhenish Center Party in Wilhelmine Germany, Milwaukee 2000
Linsenmann, Andreas/Raasch, Markus (Hg.), Die Zentrumspartei im Kaiserreich. Bilanz und Perspektiven, Münster 2015
Loth, Wilfried, Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschland,
Düsseldorf 1984
Morsey, Rudolf, Die Deutsche Zentrumspartei 1917–1923,
Düsseldorf 1966
