Die Hohenzollern und die Demokratie nach 1918
Martin Sabrow
Das Thema klingt klar umrissen und ist es doch keineswegs: Denn „die“ Hohenzollern stellten nach 1918 zu keiner Zeit die geschlossene Dynastie dar, wie sie allenfalls noch ihrem Oberhaupt Wilhelm II. im Doorner Exil vorschwebte, noch agierten sie im Rahmen einer einheitlichen politischen Kultur und Öffentlichkeit. Das Spektrum der entmachteten Familie reichte schon vor 1945 von nationalsozialistischen Aktivisten wie August Wilhelm bis hin zu demokratisch gesinnten Nachfahren wie Louis Ferdinand, die zumindest in ihrer autobiographischen Selbstdarstellung dem Widerstand gegen Hitler nahegestanden haben wollten.
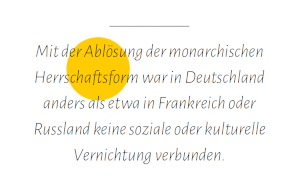
Ausgangspunkt aller Betrachtung ist der Umstand, dass mit der Ablösung der monarchischen Herrschaftsform in Deutschland anders als etwa in Frankreich oder Russland keine soziale oder kulturelle Vernichtung verbunden war. Stattdessen vollzog sich die staatsrechtliche Umwälzung in einer „Mischung von Bewahrung und Distanz“: Königliche Schlösser wurden nach 1918 nicht zu republikanischen Regierungssitzen umgeformt oder als greifbares Zeichen historischer Überwindung geplündert und geschleift. Das Haus Hohenzollern hat der Republik von Weimar diese Milde nicht gelohnt. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass sich der Monarchismus als abgegrenzte politische Haltung erst ausbilden konnte, nachdem die monarchische Ordnung mit der Novemberrevolution ihre Selbstverständlichkeit verloren hatte. Daraus gingen in den vierzehn Jahren der ersten deutschen Republik zwei gegeneinander laufende Linien hervor: Die eine markiert die allmähliche Einebnung des grundsätzlichen Gegensatzes zwischen republikanischer und monarchischer Welt und die zunehmende Integration der entmachteten Kaiserfamilie in die bürgerliche Gesellschaft; die andere Linie beschreibt im Kontrast dazu die Herausbildung und Festigung eines monarchischen Gegenmilieus, das sich um restaurative Inseln wie das holländische Exil Ex-Kaiser Wilhelms II., die Person seines Sohnes Wilhelm, den medialen Preußenkult oder die Traditionspflege einer ganzen Stadt wie Potsdam herum kristallisierte.
Zum besonderen Kristallisationsort eines restaurativen Monarchiegedankens avancierte in den Weimarer Jahren mit Potsdam die Stadt, die von den Hohenzollern geprägt war wie keine andere und mit Berlin um den ersten Rang als Hohenzollernsche Grablege wetteiferte. Welche Rolle die Stadt als monarchistischer Traditionsort in der Weimarer Republik spielte, trat insbesondere bei der Beisetzung der am 11. April 1921 in Doorn verstorbenen und nach Potsdam überführten Kaisergattin Auguste Victoria (geb. 22.10.1858) zutage, die zu einer förmlichen Apotheose der monarchischen Idee wurde. Ein hitziger Kulturkampf entbrannte nach den Attentaten der frühen Weimarer Republik auch um das in Straßennamen und Platzbezeichnungen bewahrte Erinnerungsinventar an die Hohenzollernherrschaft. Während so Monarchismus und Republikanismus ihre Fehden austrugen, schritt paradoxerweise zugleich eine allmähliche Integration der Hohenzollern und ihres Erbes in die neue Ordnung voran. Für diese Integration erbrachte der neue Staat enorme Vorleistungen, während die entmachtete Herrscherfamilie mit ihrem exilierten Oberhaupt rhetorisch unbeirrt die „Entfachung der großen Nationalen Bewegung mit dem Ziel der Wiederherstellung der Monarchie“ beschwor und sich eher ungewollt und hinterrücks zur Anpassung an die neuen Verhältnisse gedrängt sah. Im Zuge der Novemberrevolution hatte der Rat der Volksbeauftragten nicht zuletzt aus Sorge vor alliierten Reparationsforderungen eine entschädigungslose Enteignung der deutschen Fürstenhäuser gescheut und die preußische Regierung die Apanagen für die Kaisersöhne lediglich um 25% gekürzt, ansonsten aber weiterlaufen lassen und bis Sommer 1919 sogar aus der Staatskasse finanziert.
Während in anderen Ländern des Deutschen Reiches in den Folgejahren eine gütliche Einigung erfolgte, wie sie etwa in der Gründung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds 1923 zum Ausdruck kam, blieb die Vermögensauseinandersetzung im Fall der Hohenzollern lange strittig. Nach einem gescheiterten Volksentscheid auf Reichsebene kam es in Preußen im Oktober 1926 zu einer Einigung, die den Hohenzollern gut 60% des beschlagnahmten Vermögens an Grund und Boden zusprach und dem preußischen Staat knapp 40%, dazu die Mehrzahl der Hohenzollernschlösser und weitere Vermögenswerte, darunter Tausende von Kunstgegenständen.
Der Vergleich bildete die Grundlage für eine allmähliche Musealisierung des Politischen. Wie in Bayern, wo der ehemalige Kronprinz Rupprecht eine Wittelsbacher Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft ins Leben rief, die zur Verwalterin eines großen Teils der Bestände der Münchner Museen wurde, verschob sich auch der Fokus des öffentlichen Wirkens der Hohenzollern allmählich von der Restaurationspolitik zur Kulturpflege. Auf Grundlage der 1926 erfolgten Einigung wandelten sich die ehemaligen Residenzschlösser in Berlin zu Schlossmuseen, deren Interieur häufig nach musealen Gesichtspunkten aus dem früheren Nutzungszusammenhang entnommen und zur Verstärkung musealer Sammlungen an anderer Stelle verwendet wurden.
Vergleichbare Schritte zur dynastischen Abrüstung taten auch die Mitglieder des entmachteten Kaiserhauses, nur dass er in ihrem Fall Zug um Zug von der sozialen Machtverkörperung zur familiären Privatisierung führte. Schon der fest auf seine Rückkehr hoffende Ex-Kaiser präsentierte sich im Exil weniger als restaurationsbeflissener Ränkeschmied und Herold der Gegenrevolution, sondern vorzugsweise als Privatier, dessen größte Passion das Holzhacken war und der seine Sägeleistung gern zur Schau stellte. Der frühere Kronprinz Wilhelm trat in der Öffentlichkeit bevorzug als Sportenthusiast und Lebemann in Erscheinung, und Prinz Oskar gab sich betont als Privatmann, der seine Freunde nicht nach dem Gotha aussucht.
Doch die allmähliche Integration des Hauses Hohenzollern in die bürgerliche Gesellschaft der Zeit nach 1918 bildet nur die eine Seite der Medaille. Denn neben dem kulturellen Monarchismus, der mit der Kraft des Faktischen eingehegt und überformt wurde, wirkte in der Weimarer Republik auch ein politischer Monarchismus, der seine starken Bastionen im Beamtentum wie in der Reichswehr hätte zur Geltung bringen können, um gezielt auf die Abschaffung der Weimarer Ordnung hinzuarbeiten. Mit der Rückübersiedlung des ehemaligen Kronprinzen nach Deutschland wurde die politische Bühne Weimars zudem seit Ende 1923 um einen Akteur ergänzt, der die vielen unterschiedlichen Monarchiehoffnungen auf ein wenigstens in Umrissen erkennbares Volkskönigtum bündelte und vor allem den stärksten Mangel jeder legitimistischen Restaurationspolitik beseitigte: Im Gegensatz zu seinem in Doorn festgehaltenen Vater stand Wilhelm jr. als Kronprätendent im Wartestand politisch zur Verfügung. Vor allem aber haftete ihm nicht das auch in nationalkonservativen Kreisen gepflegte Odium des kaiserlichen Thronflüchtlings an, der im Herbst 1918 Volk und Heer im Stich gelassen hatte, um sich ins Exil zu retten, statt an der Spitze seiner Truppen gegen die Revolution in der Heimat zu marschieren oder den Heldentod an der Front zu suchen.
Doch so stark und machtvoll der Monarchismus als kulturelle Strömung wirkte und auch in der Republik an „Kaiserwetter“ und „Kaisergeburtstag“ festhielt, so schwach blieb er auch in der späteren Weimarer Republik als politische Bewegung. In seinem holländischen Exil ohne Einfluss auf die Politik der Weimarer Republik, erging sich der abgedankte Kaiser im Bannkreis seiner zweiten Frau Hermine von Schönaich-Carolath in brieflichen Worttiraden, die die Weimarer Republik als von Juden vorbereitet und aufrechterhalten hinstellten. Doch die Haus Doorn durchwehende Hoffnung auf eine Restauration der Monarchie, die dem exilierten Herrscher Gelegenheit geben würde, die Dinge daheim „schon wieder in Schwung (zu) bringen als Diktator“ und die Weimarer „Revolutionshelden“ zu hängen, sah sich Jahr um Jahr enttäuscht, bis der nationalsozialistische Aufstieg einen Umschwung zu bringen schien:
„In Doorn hört man seit Monaten nur noch, daß die Nationalsozialisten den Kaiser auf den Thron zurückbringen werden“,
beobachtete Wilhelms Flügeladjutant Sigurd von Ilsemann Ende 1931. Zweimal empfing der Ex-Monarch in Doorn Hermann Göring, um die NS-Bewegung hinter sich und seine Rückkehrambitionen zu bringen. Und wenige Tage vor Hitlers Regierungsübernahme ließ er in einer seiner berühmt-berüchtigten Randbemerkungen wissen, was er von der nächsten Zukunft erwarte: „Man rufe mir, ick komme! Amen.“
Die Fehlperzeption des in seinen Hass- und Revanchephantasien eingesponnenen Kaisers a.D. trug groteske Züge. Aber auch der frühere Kronprinz Wilhelm hatte nicht die Statur, um das „politische und symbolische Vakuum“ zu füllen, das der unrühmliche Sturz der Monarchie 1918 hinterlassen hatte, wenngleich die Rolle, die er in der Spätphase der Weimarer Republik spielte, bis heute in der Forschung umstritten ist. In der Gesamtwürdigung wird man nicht umhinkommen, dem Haus Hohenzollern und besonders dem ehemaligen Kronprinzen eine nicht unerhebliche Mitverantwortung für die nationalsozialistische Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft 1933 zuzuerkennen.
Entgegen einer teleologischen Betrachtung, die ungeprüft von der Wirkung auf die Absicht schließt, bleibt allerdings zugleich festzuhalten, dass Hitler und die Hohenzollern sich auf der Grundlage von ideologischer Nähe und politischer Konkurrenz wechselseitig für ihre Zwecke einzuspannen suchten. Um sich die Unterstützung durch den Kronprinzen zu sichern, hatte ihm Hitler bereits 1926 so listig wie lügnerisch versichert, allein die Wiederherstellung der Hohenzollernmonarchie anzustreben. Aber auch Wilhelm spielte mit mehreren Karten und war sich anders als sein 1930 in die NSDAP eingetretener und ein Jahr später in der SA zum Standartenführer aufgestiegenen Bruder August Wilhelm („Auwi“) lange unschlüssig, ob er mehr auf den mit ihm befreundeten Hindenburg-Intimus Kurt von Schleicher oder aber auf den rabaukenhaften Hitler setzen sollte. Die historische Verantwortung der Hohenzollern liegt in der „Bereitschaft zum Bündnis mit der NS Bewegung“, wie Stephan Malinowski bündig feststellte; und die historiographische Gewichtung dieser Verantwortung bezieht zugleich die instrumentelle Zweckbindung dieses Bündnisses ein, das aus Hitler keinen Monarchisten machte und aus Wilhelm jr. keinen Nationalsozialisten.
