Ausgrenzung und Opposition: Sozialdemokratische Arbeiterbewegung und Reichsgründung
Walter Mühlhausen
Als am 18. Januar 1871 im Schloss zu Versailles Fürsten, Generäle, Soldaten, Diplomaten und Höflinge das Publikum der feierlichen Proklamierung von Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser bildeten, saßen die beiden Führer der sozialistischen deutschen Arbeiterbewegung, Wilhelm Liebknecht und August Bebel, unter dem Vorwurf der Vorbereitung zum Hochverrat in Untersuchungshaft. Die Parallelität der Haft der beiden Sozialisten und der Kaiserkrönung im Schloss der französischen Könige symbolisierte in besonderer Weise über den Moment der Reichsgründung hinaus das Verhältnis zwischen neugeschaffenem Reich und aufstrebender Arbeiterbewegung. Das 1870/71 begründete Reich war nicht das, was sich die Sozialdemokratie von der lang ersehnten staatlichen Einheit erträumt hatte. Die Reichsverfassung blieb für die Sozialisten ein unvollendetes Dokument, das eben nicht das Fundament einer freiheitlichen Demokratie legte. So besaß innerhalb der Bewegung das Wort von Wilhelm Liebknecht Gültigkeit, der unmittelbar vor der Reichsgründung im Reichstag des Norddeutschen Bundes das sich abzeichnende kommende staatliche Gebilde als den „krassesten Absolutismus“ bezeichnete, dessen Bestimmung es sei, eine „fürstliche Versicherungsanstalt gegen die Demokratie“ zu etablieren.[1]
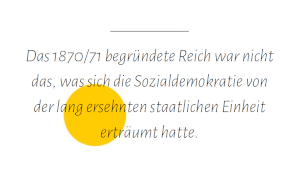
Diese Einschätzung teilten beide zu diesem Zeitpunkt noch getrennt marschierenden sozialdemokratischen Parteien, der von Ferdinand Lassalle 1863 begründete „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ und die 1869 in Eisenach ins Leben gerufene „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“. Programmatisch lagen sie nicht weit auseinander, unterschieden sich aber vor der Reichseinigung in ihren Zielperspektiven. Auf der einen Seite präsentierten sich die Lassalleaner als zentralistisch und eher kleindeutsch-preußisch orientiert, während auf der anderen Seite die Eisenacher eine doch eher föderativ großdeutsche und anti-preußische Haltung einnahmen. Diese Divergenzen spülte die Reichsgründung fort, denn die Frage „kleindeutsch“ oder „großdeutsch“ war faktisch entschieden.
Mit dem Ausbruch des deutsch-französischen Waffengangs im Juli 1870 hatte sich die Sozialdemokratie zu entscheiden. Es kam zu einer dreifachen Spaltung: Die Mehrheit ging zunächst von einem deutschen Verteidigungskrieg aus; die Lassalleaner stimmten den Kriegskrediten zu und kritisierten, kulminierend im Vorwurf des Landesverrats, die Eisenacher Bebel und Liebknecht, die sich bei der von der Regierung beantragten Kriegskreditvorlage der Stimme enthielten. Bebel und Liebknecht begründeten ihre Enthaltung: Eine Zustimmung käme einem Vertrauensvotum für die preußischen Regierung gleich, eine Ablehnung einer Billigung der verbrecherischen Politik des Kriegsgegners, von Napoleon III. Der dritte Eisenacher Abgeordnete Friedrich Wilhelm Fritzsche votierte dafür und befand sich damit in Übereinstimmung mit dem Braunschweiger Ausschuss, dem Leitungsgremium seiner SAPD.
Die Erfolge der deutschen Truppen und die Gefangennahme Napoleons III. schufen eine vollkommen neue Lage, die wiederum zu einer Änderung der Haltung der Sozialdemokratie führte. Die zweite Kriegsanleihe im November 1870 lehnten die Mandatsträger von ADAV und SDAP einmütig ab, denn jetzt war der expansive Charakter des Krieges offenkundig. Als Verteidigung konnte das nicht mehr gesehen werden, jedenfalls nicht mehr aus dem sozialdemokratischen Blickwinkel. Die gegen die Kriegsanleihen opponierende Sozialdemokratie war von nun an staatlichen Übergriffen ausgesetzt. Bebel und Liebknecht wurden am 17. Dezember 1870 verhaftet. So blickte die Sozialdemokratie aus zwei Perspektiven auf die Gründung des deutschen Nationalstaates: Positiv vermerkte sie die Herstellung der Reichseinheit, negativ blieb für sie, dass dieses neue Reich keine freiheitlich-demokratische Ordnung darstellte, ja gegenüber der organisierten Arbeiterbewegung gar noch Repressionen bereithielt. Für die fehlende innere Demokratisierung galt es nun zu kämpfen.
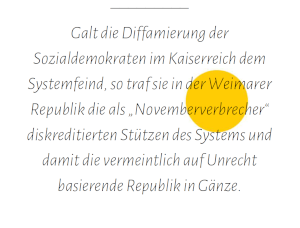
Es war der Eisenacher Bebel, der im Mai 1871 im Reichstag die Solidarität der deutschen Sozialisten mit der Pariser Kommune bekundete. Dabei prophezeite er, dass deren Kampf gegen die bürgerliche Republik nur ein kleines Vorpostengefecht sei und bald ganz Europa erfassen werde.[2] Mit diesen Worten schürte der später als Arbeiterkaiser verehrte Bebel eine weit um sich greifende Revolutionsfurcht. Reichskanzler Bismarck behauptete jedenfalls später, dass die Rede des Arbeiterführers wie ein Lichtstrahl gewirkt und zur Erkenntnis geführt habe, „in den sozialdemokratischen Elementen“ sei ein Feind zu sehen, „gegen den der Staat, die Gesellschaft“ sich in einer Notwehrsituation befinden würde.[3] Die Sozialdemokratie goss durch entsprechende revolutionäre Wortwahl und visuelle Darstellungen mit Bildnissen vom roten Gespenst und petroleumbepackten Brandstifter Öl in das Feuer dieser um sich greifenden Sozialistenhysterie. Ihre breite Intensität muss schon erstaunen, denn im Mai 1871 verfügten die Sozialdemokraten gerade einmal über zwei Mandate (von 382 im ersten Reichstag). Lediglich 3,2 Prozent der Wähler standen hinter ihr. Nur eine surreale Notstandspanik mag annähernd erklären, dass Bismarck mit schwerstem Geschütz auf Spatzen zu schießen gewillt war – und letztlich vollkommenen Schiffbruch erlitt.
Die Sozialdemokratie als Emanzipationsbewegung, die Gleichberechtigung aller Staatsbürger und Demokratisierung der Gesellschaft auf ihre Fahnen schrieb, wurde als Herausforderung für den Staat begriffen. Grundlage des Kampfes gegen die Sozialdemokratie in den zwei Jahrzehnten der Amtszeit Bismarcks bildeten jene beiden Elemente, die er im Oktober 1871 in einer für einen preußischen Minister bestimmten Aufzeichnung umriss: auf der einen Seite Entgegenkommen bei den Wünschen der arbeitenden Klassen durch Gesetzgebung und Verwaltung, auf der anderen Seite Hemmung der Agitation mit Hilfe von Verbots- und Strafgesetzen. In dieser Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ – wie das im sozialdemokratischen Sprachgebrauch hieß – wurde zunächst die Knute hervorgeholt und mit aller Härte unter Ausnutzung der gegebenen rechtlichen Möglichkeiten gegen die Sozialdemokratie vorgegangen. Bebel und Liebknecht wurden dann 1872 in Leipzig wegen Vorbereitung des Hochverrats zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, durch Gründung der sozialistischen Partei, durch Mitarbeit der 1864 in London ins Leben gerufenen Internationalen Arbeiter-Assoziation planmäßig den Umsturz vorbereitet zu haben.
Solche Verfahren erzielten nicht die erhoffte Wirkung, die Sozialdemokratie einzudämmen, sondern verschafften ihr im Gegenteil Popularität, führten ihr neue Mitglieder zu und stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewegung. So erreichte Bebel, der in einem weiteren Verfahren noch neun Monate Haft wegen Majestätsbeleidigung erhielt und dem gerichtlich das Reichstagsmandat aberkannt wurde, bei der notwendigen Nachwahl 1873 eine größere Stimmenzahl als zwei Jahre zuvor. Der mit der Reichsgründung verstärkt einsetzende Druck auf Lassalleaner und Eisenacher beschleunigte deren Annäherung, die dann 1875 in Gotha mit der Gründung der „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ (SAPD) vollendet wurde.
Nach zwei Attentaten auf den Kaiser im Frühjahr 1878 holte Bismarck das Ausnahmegesetz aus dem Waffenarsenal. Das schließlich auf insgesamt zwölf Jahre ausgedehnte Sozialistengesetz stellte die SAPD außerhalb der Legalität. Ihr blieben als Betätigungsfelder lediglich Parlament und Wahlen. Das Gesetz bestärkte das Misstrauen des sozialdemokratisch organisierten Arbeiters gegenüber dem Staat, den er als Unterdrückungsinstrument erlebte, und leistete der Durchsetzung der marxistischen Theorie in der Arbeiterbewegung Vorschub. Gegen Repression des Staates und gesellschaftliche Ausgrenzung boten sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften Zuflucht und Heimat zugleich. Ihr Wachstum konnte nicht gebremst werden. Am Ende des Ausnahmegesetzes 1890 stand die SAPD innerlich gefestigter und mit einem weitaus größeren Zuspruch als 1878 (7,6 Prozent/9 Mandate) da: 19,7 Prozent und 35 Sitze (von 397).
Auch nach dem Sozialistengesetz gehörte es zur Staatsräson, die sozialistische Bewegung niederzuhalten. Die Sozialdemokratie, die sich der Internationalität verschrieb, die nicht den nationalen Gedenktag der erfolgreichen Schlacht bei Sedan feierte, sondern am 18. März an die Barrikadenkämpfe der Revolution von 1848 und an den Aufstand der Kommune von 1871 erinnerte und dann ab 1890 den 1. Mai als Feiertag des internationalen Proletariats beging, musste zwangsläufig in den Verdacht der nationalen Unzuverlässigkeit geraten. Ihre Mitglieder wurden als Agenten der Internationale, als vaterlandslose Gesellen abgestempelt. Innerhalb der Sozialdemokratie kam es einem Ritterschlag gleich, als Reichsfeind verfolgt, aus der Arbeit entlassen, des Ortes verwiesen oder gerichtlich belangt worden zu sein.
In Deutschland bildete sich nicht zuletzt aufgrund der verspäteten Reichsgründung und der dauerhaften Repression eine einzige zentralistische sozialdemokratische Partei, die durch diese Organisation nachgerade befähigt war, innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung eine führende Rolle zu übernehmen. Gradmesser des innenpolitischen Erfolges waren ständig steigende Mitglieder- und Wählerzahlen. Die SPD eilte von einem Wahlsieg zum nächsten. „Für uns wurde jeder Wahltag ein Zähltag“, umriss Parteivorstandsmitglied Hermann Molkenbuhr zur 50-Jahr-Feier der Parteigründung die unbedingte Orientierung auf den Stimmzettel.[4] 1907 bei den sogenannten „Hottentottenwahlen“ hatte man jedoch, als Vaterlandsverräter an den Pranger gestellt, einen herben Rückschlag erhalten, der den Glaubenssatz vom kontinuierlichen Zuwachs ins Wanken brachte. Nun galt es, die nationale Zuverlässigkeit zu demonstrieren.
Was folgte, war ein „zwar zuerst nur feiner, dann sich aber ständig verbreitender Riss innerhalb der SPD, was ihre Stellung zu Nation und Vaterland anging“.[5] Es kristallisierte sich immer mehr eine Linie heraus, die ihre positive Haltung in der Frage der Nation auch öffentlich bekunden wollte. Das hing auch damit zusammen, dass die zweite Generation von Arbeiterführern, jene der Geburtsjahrgänge 1861 bis 1884, nach vorn drängte und die Partei zu dominieren begann. Diese zweite Generation besaß eine weit größere Integrationsfähigkeit und Integrationswilligkeit in das politische System als die Vorgängergeneration der Parteigründer. Das Weltbild der jüngeren Alterskohorte hatte sich nach dem Sozialistengesetz in einer intakten und rasch wachsenden Organisation geformt und verfestigt. In der Tat entsprang aus der durch gesellschaftliche Ausgrenzung, Legalität und Wachstum bedingten Binnenorientierung auf die Partei ein ausgeprägter Organisationspatriotismus, ja geradezu ein Organisationsfetischismus. Überspitzt formuliert: Nicht die Bewegung war alles, sondern die Parteiorganisation. Das war prägend. Gestärkt wurde dabei ein Praktizismus, eine Hinwendung zum Machbaren, was die Bereitschaft zur politischen Anpassung an das System (und seine politischen Mechanismen), aber nicht dessen Akzeptanz beförderte.
So wuchs neben der revolutionären Richtung ein reformistischer Flügel, der den Blick nicht auf den sozialistischen Zukunftsstaat ausrichtete, sondern das Hier und Heute verbessern wollte. Es ging ihm nicht um Sturz des Systems, sondern um Umformung über schrittweise Demokratisierung durch parlamentarische Mitarbeit. Das Erfurter Programm von 1891, im zweiten Jahr nach dem Fall des Sozialistengesetzes verabschiedet, bot mit einem theoretischen (marxistischen) ersten Teil und einem praktizistischen (reformerischen) zweiten Teil beiden Strömungen programmatischen Rückhalt. Das erklärt auch, warum auf reformistischer Seite der von Eduard Bernstein begründete Revisionismus, der die Theorie den reformpolitischen Erfordernissen anpassen, die revolutionäre Phraseologie durch ein klares Bekenntnis zur demokratisch-sozialistischen Reformpartei ersetzen wollte, nicht mit Begeisterung aufgenommen wurde. Reformismus und Revisionismus galten auch im Bürgertum als sichtbares Zeichen der „Mauserung“ der SPD, wie die Abkehr von alter revolutionärer Programmatik hin zur reformistischen Praxis auf bürgerlicher Seite benannt wurde. Aus solcher Perspektive verlor die Sozialdemokratie ihre Schrecken.
Als im August 1914 die SPD-Fraktion, mittlerweile mit 110 Abgeordneten die stärkste im Reichstag (mit 34,8 Prozent der Wähler im Rücken), für die Bewilligung der Kriegskredite stimmte, überraschte dies die Öffentlichkeit. Aber das Votum lag in der Linie der Mehrheit in der SPD, die im Grunde zu einer nationalen Partei geworden war, die ihr Schicksal mit dem des Reiches, resp. der Nation (nicht des Systems!) verknüpfte. Mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten schlossen die Sozialdemokraten zugleich den Burgfrieden.
Bei Ausbruch des Weltkrieges blickte die deutsche Sozialdemokratie auf eine wechselvolle 50-jährige Parteigeschichte zurück. Zahlreiche innerparteiliche Krisen und Kontroversen hatten sie zwar erschüttert, aber die 1875 geschaffene Einheit der Partei und ihren kontinuierlichen Aufstieg nicht ernsthaft gefährden können. Doch der Weltkrieg stürzte die SPD in ihre bis dahin schwerste Zerreißprobe, die schließlich 1917 in eine dauerhafte Spaltung mündete, deren Auswirkungen auch heute noch in der Parteienlandschaft zu spüren sind.
Doch nicht nur die Spaltung 1917 sollte die 1918/19 ganz wesentlich von den Sozialdemokraten aus der Taufe gehobene Republik belasten. Hinzu kam ein weiteres Relikt der Reichsgründungszeit, die in den seinerzeitigen Auseinandersetzungen geprägten und über die Kaiserzeit hinaus bestehenden Verhaltensmuster und Stereotypen in jenen Kreisen, für die die SPD staatenlose Staatsfeinde waren und es auch blieben. Die nationalistische antidemokratische Rechte sah in der ersten deutschen Demokratie von Weimar das bestätigt, was sie seit der Anfangsphase des Kaiserreichs glauben wollte: Die Sozialdemokratie, die man als „vaterlandsverräterische Lohndirne ausländischer Kriegshetzer“ außerhalb der Gesellschaft gestellt hatte, deren Mitglieder als Reichsfeinde, vaterlandslose Gesellen und „finstere Volksverderber“[6] gebrandmarkt worden waren, wurde verantwortlich gemacht für die Kriegsniederlage und die Folgen in Gestalt des als Schmach empfundenen Versailler Vertrages. Die unselige Dolchstoßlüge wurde zum probaten Transporteur dieses Irrglaubens, die auch Basis für den Landesverratsvorwurf in Richtung des ersten Reichspräsidenten, des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert war, der in einem von über 200 von ihm angestrengten Verleumdungsverfahren 1924 tatsächlich juristisch bestätigt werden sollte. Nicht nur der vormalige kaiserliche Heerführer Erich Ludendorff sah es nach dem Skandalurteil als erwiesen an, dass die Sozialdemokraten „schuldig des Landesverrats und strafwürdige Verbrecher“ seien.[7] Dieser politische Rufmord konnte nur auf dem 50 Jahre zuvor gesäten und seitdem stets genährten Antisozialdemokratismus reifen.
An Gefährlichkeit hatte die in der Reichsgründerzeit geborene antisozialdemokratische Propaganda nichts eingebüßt – im Gegenteil: Galt die Diffamierung der Sozialdemokraten im Kaiserreich dem Systemfeind, so traf sie jetzt die als „Novemberverbrecher“ diskreditierten Stützen des Systems und damit die vermeintlich auf Unrecht basierende Republik in Gänze. Letztendlich war dies eine der Ursachen für den Untergang Weimars. Und man geht gewiss nicht fehl in der Interpretation, dass vieles auch noch in die politische Kultur der Adenauer-Zeit hinüberschwappte, wenn Exilanten („Brandt alias Frahm“) und/oder Sozialdemokraten (CDU-Plakat: „Alle Wege führen nach Moskau“) der nationalen Unzuverlässigkeit bezichtigt wurden.
Literatur:
Brandt, Peter/Lehnert, Detlev, „Mehr Demokratie wagen“. Geschichte der Sozialdemokratie 1830–2010, Berlin 2013
Grebing, Helga, Arbeiterbewegung. Sozialer Protest und kollektive Interessenvertretung bis 1914, München 1985
Groh, Dieter/Brandt, Peter, Vaterlandslose Gesellen. Sozialdemokratie und Nation 1860–1990, München 1992
Mühlhausen, Walter: Strategien gegen den Systemfeind – Zur Politik von Staat und Gesellschaft gegenüber der Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich 1871–1914, in: Lademacher, Horst/ Mühlhausen, Walter (Hg.), Freiheitsstreben – Demokratie – Emanzipation. Aufsätze zur politischen Kultur in Deutschland und den Niederlanden, Münster 1993, 283–329
Schönhoven, Klaus/Braun, Bernd (Hg.), Generationen in der Arbeiterbewegung, München 2005
Steinberg, Hans-Josef, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem 1. Weltkrieg, 5. Aufl., Berlin/Bonn 1979
[1] Auf der Sitzung am 9. Dezember 1870; Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, I. Legislatur-Periode (II. Außerordentliche Session 1870), Berlin 1870, S. 154.
[2] Stenographische Berichte über die Verhandlungen im Deutschen Reichstage. 1. Legislaturperiode, S. 921
[3] Bei seiner Grundsatzerklärung zum Sozialistengesetz am 17. September 1878. Wieder abgedruckt in: Bismarck. Die großen Reden. Herausgeg. und eingel. von Lothar Gall, Berlin 1981, S. 186.
[4] „Hamburger Echo“ Nr. 120 vom 25. Mai 1913.
[5] Groh/Brandt (1992): Gesellen, S. 115 ff.
[6] Mühlhausen (1993): Strategien, Zitate S. 287 und S. 288.
[7] Walter Mühlhausen: Friedrich Ebert 1871–1925. Reichspräsident der Weimarer Republik, Bonn 22007, Zitat S. 954.
