Streitkultur im Kaiserreich. Politische Versammlungen zwischen Deliberation und Demonstration
Theo Jung
Die Erfahrung mit politischer Polarisierung hat die Frage nach den kommunikativen Formen des politischen Austausches neuerdings wieder verstärkt auf die Agenda gesetzt. Ist der Tonfall öffentlicher Debatten verroht oder werden Sagbarkeitsgrenzen durch politische Korrektheit gerade immer mehr eingeschränkt? Inwiefern treffen unterschiedliche Meinungen überhaupt noch aufeinander, wo sie sich doch allzu leicht in ihren jeweiligen Echokammern einigeln können? Und ist es überhaupt immer wünschenswert, mit Rechten/Linken zu reden, oder gibt es einen Punkt, an dem die gemeinsame Basis für einen sinnvollen Austausch fehlt? Im Hintergrund solcher Kontroversen steht die Überzeugung, dass Demokratie auf eine bestimmte Form der Konfliktkommunikation angewiesen ist. Nur eine gesunde Streitkultur, in der Konflikte im offenen Austausch von Argumenten ausgetragen und eingehegt werden, vermag die in modernen Gesellschaften nun mal unvermeidliche Pluralität von Standpunkten und Interessen kommunikativ zu überbrücken. In früheren Jahrzehnten galt das Deutsche Kaiserreich oft als Kontrastfolie zu diesem deliberativen Ideal. Das Pendant zum Bild eines repressiven Obrigkeitsstaats war die Vorstellung einer diskussionsunfähigen Untertanengesellschaft. In der Öffentlichkeit wie in der Historiografie dominierte die etwa von Norbert Elias vertretene Diagnose, nach der der „Verkehrskanon“ des Kaiserreichs auf die „Umgangsstrategie des Befehlens und Gehorchens“ anstatt des „Überredens und Überzeugens“ ausgerichtet gewesen sei (Elias 1990, 90–91), mit verheerenden Folgen für die langfristige politische Entwicklung Deutschlands. In jüngerer Zeit sind jedoch vermehrt gegenläufige Stimmen laut geworden. Vor allem mit Blick auf die Wahlkultur haben wichtige Teile der Forschung die Möglichkeiten von Bürgern betont, im undemokratischen Rahmen Demokratie zu praktizieren (im Sinne des Aus- wie des Einübens). Gegen die Vorstellung von einer mundtoten oder mundfaulen Gesellschaft wird dabei auch die Vitalität der Diskussionskultur des Kaiserreichs hervorgehoben. Einen zentralen Aspekt bildet dabei die politische Versammlung. Eine nähere Betrachtung der sich wandelnden Rollen von Rednern, Gegenrednern, Publikum und Außenseitern in ihrem Kontext kann dazu beitragen, die Ambivalenzen und Wandelbarkeit der Streitkultur des Kaiserreichs hervorzuheben.
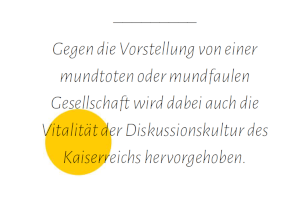
Nach der Reichsgründung bildeten sich im internationalen Vergleich schnell feste Parteienstrukturen heraus. Um sie herum entstand eine Versammlungsform, die sich von den spontanen Ansammlungen im Kontext von besonderen Ereignissen oder Protesten durch eine streng reglementierte, quasi-parlamentarische Organisationsform unterschied. In den ersten Jahrzehnten dominierte dabei der „kontradiktorische“ Versammlungstypus, bei dem sich Vertreter verschiedener Richtungen vor einem heterogenen Publikum einen rhetorischen Schlagabtausch lieferten. Bei gemischten Versammlungen teilten sich beispielsweise liberale und sozialdemokratische Redner das Podium „in einem Ton der Konzilianz oder gar der Freundschaft“ (Stampfer 1957, 45–46). Aber auch bei Parteitreffen wurde regelmäßig Zeit für sogenannte Diskussionsredner eingeräumt. Die Parteien entsandten ihre besten Redner zu den Versammlungen ihrer Gegner, um dort für ihre Standpunkte einzutreten. Sie wurden im Vorfeld beim Präsidium angemeldet und konnten mit mindestens einer halben Stunde Sprechzeit rechnen. Wenn der Vorsitzende ihre Beiträge doch einmal vorschnell abkürzte, führte dies zu lautstarken Protesten, auch aus dem eigenen Publikum. Wer gar keine Gegner einlud, setzte sich dem Verdacht aus, den argumentativen Kampf zu scheuen. Wenn sich kein Gegenredner fand, platzierten Parteien deshalb gelegentlich sogar selbst Personen im Publikum, um wenigstens pro forma eine konträre Stimme aufkommen zu lassen. Da das Publikum solcher Veranstaltungen meist gemischt war und durch Fragen, Kommentare, Zwischenrufe und andere Reaktionen aktiv in das Geschehen eingriff, betrachteten viele Zeitgenossen solche Veranstaltungen als Quasi-Volksversammlungen, die als zwar nur momentane, aber doch allgemeine Repräsentation des Volkswillens gelten durften.
Eine besondere Bedeutung hatte die Institution des Diskussionsredners für die Sozialdemokraten, für die sie oft die einzige Möglichkeit darstellte, sich Gehör zu verschaffen. Unter den Sozialistengesetzen, als es ihnen verboten war, eigene Veranstaltungen abzuhalten, nutzten sie die Treffen anderer Parteien, um ihre Stimme in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch danach blieb der Diskussionsredner eine wichtige Waffe, vor allem im ländlichen Raum, wo die eigene Anhängerschaft dünn gesät, die Obrigkeit feindlich gesinnt und die Inhaber von Wirtshäusern wenig erpicht darauf waren, Genossen ihre Räumlichkeiten zu überlassen. So traten etwa im Saarland selbst die prominentesten Sozialdemokraten nicht auf eigenen Veranstaltungen auf, sondern bei den Kundgebungen des Zentrums oder sogar des berüchtigten Freikonservativen Freiherrn von Stumm.
Der Hinweis auf die Bedeutung der kontradiktorischen Versammlung vermag das Bild einer generell diskussionsunfähigen Gesellschaft zu differenzieren. Doch darf eine solche Korrektur nicht dazu verleiten, die Konstellation nun umgekehrt zu idealisieren. Besonders die sozialdemokratischen Gegenredner waren keinesfalls immer willkommen, und wenn sie doch empfangen wurden, blieben Konflikte nicht immer aus. Aufgrund der Heterogenität der Teilnehmer konnte die Atmosphäre solcher Veranstaltungen durchaus ruppig sein, vor allem wenn sich die Publikumsteilnahme nicht auf Fragen und Diskussionsbeiträge beschränkte, sondern in Zwischenrufe und andere Störungen überging. Zweitens ist daran zu erinnern, dass die Versammlungen stets nur eine Arena unter mehreren darstellten. Wie Armin Owzar (2006) am Beispiel Hamburgs gezeigt hat, bildete ihre lagerübergreifende Diskussionskultur in mancher Hinsicht gerade das Gegenstück zur Alltagskommunikation. Während die Vertreter der jeweiligen Eliten auf der öffentlichen Bühne ihre Wortgefechte austrugen, schotteten sich die sozialmoralischen Milieus am Arbeitsplatz, im Familienleben und bei der Freizeitgestaltung voneinander ab. Schließlich können die fast fünf Jahrzehnte des Kaiserreichs mit Blick auf die Streitkultur der Versammlungen keineswegs als einheitlich betrachtet werden.
Ab den 1880er Jahren zeichnete sich ein zunächst schleichender, auf Dauer aber eingreifender Charakterwandel ab. Philipp Scheidemann beschrieb in seinen Memoiren, wie die Gelegenheiten, mit Gegnern zu debattieren, immer seltener wurden. Sozialdemokratische Diskussionsredner wurden nicht mehr eingeladen und oft auch nicht mehr geduldet (Scheidemann 1928, I, 71). Immer öfter waren die Versammlungen auf einen einzigen Hauptredner ausgerichtet. Dadurch entfiel nicht nur die Debatte auf dem Podest, sondern auch die argumentative Interaktion mit dem Publikum. Während dieses durch Platzkartenvergabe auf die eigene Anhängerschaft eingeschränkt wurde, beschränkte sich seine Rolle zunehmend auf Anwesenheit und lautstarke Unterstützung, durch die die zahlenmäßige Stärke und Energie des eigenen Lagers performativ unter Beweis gestellt wurden. So gestalteten sich die Versammlungen zunehmend als Monolog mit Beifall; aus einem Ort der Deliberation wurde einer der Demonstration.
Die Schwerpunktverschiebung von der kontradiktorischen Debatte zur Parteikundgebung war in mancher Hinsicht auch eine Reaktion auf die Tumulte, die die Konfrontationen vor und mit einem gemischten Publikum regelmäßig ausgelöst hatten. Doch resultierte diese Entwicklung keinesfalls in jeder Hinsicht in Disziplinierung. Dadurch, dass Gegner nun nicht länger in den Veranstaltungsablauf eingebunden waren, waren ihre Handlungsspielräume von vornherein darauf beschränkt, von außen auf ihn einzuwirken. Außerdem verlor die Versammlung durch ihre Homogenisierung ihre repräsentative Legitimität. Gerade der eigene Ausschluss diente oft zur Rechtfertigung, gegnerische Versammlungen zu stören, zu kapern oder zu sprengen.
Die dazu angewandten Mittel waren nicht neu. Das Repertoire reichte vom Zwischenruf und lautem Lachen über das Pfeifen, Stampfen, Trommeln und Singen bis hin zur komplett ausgewachsenen Katzenmusik. Neben akustischen Störungen wurden unliebsame Redner mit Feuerwerk, Eiern, Fisch, Gemüse oder schlimmstenfalls sogar mit Steinen, Stühlen oder anderen Gegenständen beworfen. Es wurde Ruß oder Cayennepfeffer verstreut, um das Weiterreden unmöglich zu machen und in einigen Fällen arteten Rangeleien zu veritablen Saalschlachten aus. Ähnliches war zuvor auch schon vorgekommen. Was sich allerdings geändert hatte, war der Organisationsgrad. Aus einer Praxis, die in der Regel relativ spontan von einzelnen Elementen des Publikums ausgegangen war, wurde eine koordinierte Aktionsform. Parteien bildeten sogenannten Sprengkolonnen, die meist einige wenige, im Einzelfall aber bis zu 1.500 Personen umfassten, um die Versammlungen ihrer Gegner zu kapern, oder wenn das nicht gelang, ihre Auflösung zu bewirken. Das geltende Versammlungsrecht bot dafür günstige Anknüpfungspunkte. Da jede Versammlung mit der Wahl eines vorsitzenden Bureaus eröffnet werden musste, bot sich hier eine erste Gelegenheit, der organisierenden Gruppe die Kontrolle zu entreißen. Gelang dies nicht, ging man mit mehr oder weniger rabiaten Methoden zur Störung über. Da selbst geringfügige Zeichen von Unruhe für die anwesenden Polizisten oft Anlass waren, die Versammlung aufzulösen, ließ sich der Gegner auf diesem Weg effektiv zum Schweigen bringen. Eine vom Münchener Demokratischen Verein veranstaltete Rede des Wiener Gemeinderats Lucian Brunner endete 1900 in tumultuösen Szenen:
„Von Beginn warfen die Antisemiten mit Bierfilzen, faulen Aepfeln u. s. w. nach Brunner und dem Vorstandstisch. Bei der Bureauwahl skandalirten die zu einem Drittel anwesenden Antisemiten derart (Juden raus! Wir lassen keinen österreichischen Juden reden! &c.), daß auf Verlangen der Polizeibeamten die Versammlung geschlossen werden mußte. Der Beamte ging sofort weg, worauf wüste Szenen erfolgten, Schlägereien, Werfen mit Biergläsern durch die Antisemiten. Auch mehrere Verwundungen gab es“ (Heidelberger Zeitung 7.3.1900).
Infolge ihres hohen Organisationsgrades taten sich die Sozialdemokraten, die Antisemiten und das Zentrum mit solchen Praktiken besonders hervor. Aber auch Liberale und Konservative beteiligten sich um die Jahrhundertwende daran, wenn auch nur, um sich gegen den gefühlten Ansturm ihrer Gegner zu wehren. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Verteilung der jeweiligen Anhängerschaften gestalteten sich solche Auseinandersetzungen vor allem während des Wahlkampfs als territorialer Revierkampf. Das galt in den Städten, in denen die erfolgreiche Durchführung einer Veranstaltung in „feindlichen“ Vierteln als besonderer Erfolg gefeiert wurde, aber auch auf dem Land, wo sich besonders die Konservativen mit Unterstützung der lokalen Eliten und Behörden gegen den befürchteten Vormarsch der Sozialdemokratie zur Wehr setzten.
Um die eigenen Versammlungen vor Übergriffen zu schützen, ergriffen die Parteien verschiedene Gegenmaßnahmen. Als die Veranstaltungen der Freisinnigen Volkspartei im Berliner Reichstagswahlkampf des Jahres 1881 wiederholt von Antisemiten und Sozialdemokraten gekapert wurden, versuchten sie die Zusammensetzung des Publikums zunächst durch die Vergabe von Platzkarten zu regulieren. Als sich die Antisemiten jedoch immer wieder auf falschen Namen Karten besorgten, sah sich die Partei genötigt, beim Einlass eine umfassende Personenkontrolle durch eine „Privatpolizei gegen Bezahlung, zu der besonders handfeste Parteigenossen ausgewählt wurden“ einzurichten (Richter 1894, II, 202–203). Auch andere Gruppen bildeten solche inoffiziellen Schutzgruppen, die sodann auch beim Angriff auf gegnerische Veranstaltungen eine Rolle spielten. Darüber hinaus wurden interaktive Programmteile, wie die Vorstandswahl und die Diskussion, eingeschränkt. Der liberale Führer Eugen Richter machte es sogar zur Bedingung seiner „Auftritte“, dass bei der Versammlung keine Debatte stattfinde.
Wenn ein physischer Konflikt wenig erfolgversprechend schien, versuchten die Parteien, den Gegner auszutricksen. Sie kündigten Kundgebungen unter irreführenden Titeln oder erst in allerletzter Minute an, um zu vermeiden, dass sich feindliche Elemente unter das Publikum mischen konnten. Besonders die Sozialdemokraten hielten allerdings dagegen, indem sie eine Art Frühwarnsystem einrichteten. Genossen waren angehalten, ihre Parteifunktionäre schnellstmöglich telefonisch oder telegrafisch zu informieren, wenn irgendwo eine Veranstaltung angekündigt wurde, sodass sie rechtzeitig eintreffen konnten. So ergab sich ein gegenseitiger Waffenwettlauf, der, wie sich Scheidemann erinnerte, von den Sozialdemokraten „geradezu sportmäßig“ betrieben wurde (Scheidemann 1928, I, 93–97).
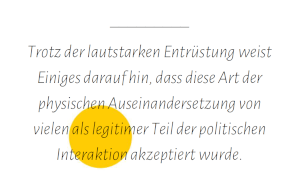
Wenig überraschend wurden gegnerische Sprengungsversuche in der politischen Gesinnungspresse allgemein skandalisiert, während dasselbe Verhalten beim eigenen Lager als Notwehr entschuldigt wurde. Im Vorwurf, dass sich der Gegner der Debatte durch unfaire Mittel entziehe, überlagerten sich Normen politischer „Mannhaftigkeit“ mit der Frage nach den legitimen Mitteln politischer Auseinandersetzung. Sofern die Versammlung weiterhin als quasi-repräsentative Volksversammlung betrachtet wurde, konnte ihre Sprengung als Mundtotmachung der vox populi empfunden (oder zumindest dargestellt) werden. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Massensoziologie wurden die Störungen als Zeichen eines generellen Verfalls der politischen Kultur gedeutet. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum solche Narrative populär waren. Einerseits knüpften sie an
Traditionen eines elitären Antipopulismus an. Andererseits ließen sie sich aber auch leicht instrumentalisieren, indem sie den jeweiligen Kontrahenten als Zerstörer des respektablen Diskurses darstellten. Doch ist auffällig, dass im öffentlichen Diskurs über solche Ereignisse neben abwertenden Ausdrücken wie „Wahlterror“ auch neutralere Bezeichnungen auftauchten. So wurden die Ereignisse etwa als sportliches Kräftemessen, als Schauspiel oder als „nachgerade ein harmloses Vergnügen“ (Laufenberg 1911, Bd. I, S. 608) beschrieben. Der Zentrumsabgeordnete Johannes Giesberts berief sich halb-ironisch auf das nun mal etablierte „Versammlungsfaustrecht“ (Reichstag, Sg. v. 21.3.1906). So mischten sich in die Empörung auch Andeutungen einer zumindest impliziten Akzeptanz einer Praxis, die auf allen Seiten des politischen Spektrums zunehmend zum Alltag gehörte.
Dazu gehörte auch, dass die Konflikte zwar einen handfesten, aber auch ritualisierten Charakter hatten. Gewöhnlich fingen die Ereignisse mit akustischen Störungen an und durchliefen danach je nach Situation und Erfolg verschiedene Eskalationsstufen, von gegenseitigen Beschimpfungen über Drohgebärden und punktuelle Handgreiflichkeiten bis hin zur „Saalschlacht“. Eskalation hieß aber nicht völlige Enthemmung. In der Regel orientierten sich beide Seiten an impliziten Regeln eines „ehrlichen“ Kampfs. Ein allzu großes quantitatives Ungleichgewicht wurde ebenso abgelehnt wie das Angreifen von Frauen, Kindern oder Greisen. Manchmal kamen neben Fäusten auch Gegenstände und sogar Waffen zum Einsatz, aber auch hier wurde von den Beteiligten auf „Verhältnismäßigkeit“ geachtet. Wer sich allzu militärisch gerierte, verließ in zeitgenössischen Augen das Feld der Politik. Schließlich hing die zeitgenössische Beurteilung von der Motivation der Beteiligten ab. Die gegenseitigen Verdächtigungen, dass es sich bei den jeweiligen Gegnern um bezahlte Schläger oder alkoholisierte Krawallbrüder gehandelt habe, verweist darauf, dass dieselbe Praxis unterschiedlich beurteilt wurde, je nachdem ob sie aus „politischen“ oder „unpolitischen“ Motiven hervorging. Auch wenn sich manche Situationen zuspitzten, blieb das Geschehen meist auf Rangeleien beschränkt, die vor allem den Charakter eines symbolischen Kräftemessens hatten. Gerade auch mit Blick auf die Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg sticht somit die Ambivalenz der Konstellation im späteren Kaiserreich hervor. Einerseits sind hier deutlich die Vorzeichen einer Politik erkennbar, die auf die gegenseitige Demonstration von Stärke ausgerichtet war (sodass auch die These, dass diese Umstellung mit der Brutalisierung aufgrund der Kriegserfahrung in Verbindung gebracht werden müsse, noch einmal zu differenzieren ist). Andererseits muss betont werden, dass es sich bei den Saalschlachten des Kaiserreichs zwar um eine wenig zimperliche, aber doch eingehegte Form der politischen Konfliktaustragung handelte, die mit den Gewaltexzessen der Spätphase der Weimarer Republik nicht in eins gesetzt werden kann.
Aus diesem knappen Überblick lassen sich vier zentrale Schlussfolgerungen ableiten. Erstens: die These von der generellen Diskussionsunfähigkeit des Kaiserreichs wird von seiner lebendigen politischen Debattenkultur Lügen gestraft. Gleichzeitig zeichnete sich darin seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein deutlicher Wandel ab, der sich als Schwerpunktverschiebung von der Deliberation zur Demonstration kennzeichnen lässt. Dass parallele Entwicklungen etwa zeitgleich auch für Frankreich und Großbritannien festgestellt worden sind (Lawrence 1998; Cossart 2010) verweist darauf, dass hier nicht nur national spezifische, sondern auch allgemeinere Faktoren zum Tragen kamen, wie die Entstehung der Massenpresse, der gesteigerte Organisationsgrad nationaler Parteien und ein politischer Mobilisierungsschub im Kontext des erweiterten Wahlrechts.
Zweitens führte die gesteigerte Organisationskraft der Parteien nicht in jeder Hinsicht zur Disziplinierung der politischen Interaktion. Von Anfang an waren die Versammlungen von einem Spannungsmoment zwischen einer quasi-parlamentarischen Formsprache und einer Vielfalt von teilweise noch in volkstümlichen Protesttraditionen gründenden Störpraktiken geprägt. Die verstärkte Einhegung solcher Unruhemomente, etwa durch die Homogenisierung des Publikums und die Einschränkung dialogischer Programmpunkte, bewirkte schließlich aber keine Pazifizierung. Vielmehr veränderte sich die Störungspraxis. Aus einem relativ spontanen, situativen Ereignis wurde ein organisierter Aktionsmodus. Nicht nur an den Extremen, sondern im ganzen politischen Spektrum bemühten sich Parteien, auch physisch die Hoheit über das Forum der politischen Versammlung zu erlangen. In manchen Fällen wurden dabei sogar Aspekte der Institutionalisierung sichtbar, wie etwa die Selektion eines auf diese Art der Auseinandersetzung spezialisierten Personals.
Drittens: Bezüglich des Umgangs mit politischer Pluralität hebt der Blick auf die Versammlungspraxis erneut die Notwendigkeit hervor, allzu eindeutige Pauschalurteile über „das“ Kaiserreich zu vermeiden. Die kontradiktorischen Versammlungen bilden einen scharfen Kontrast zu vielen anderen Bereichen, die von Abschottung, Konflikt und Repression gekennzeichnet waren, aber negieren diese nicht. Auch im Umgang mit den Störungen treten Ambivalenzen zutage. In der Presseöffentlichkeit wurden diese fast ausnahmslos skandalisiert. Parteien stellten ihre Gegner als Zerstörer der ehrlichen, argumentativen Auseinandersetzung dar. Kulturkritiker diagnostizierten eine allgemeine Krise der Debatte im Zeitalter der Massen. Doch obwohl solche Äußerungen als Teil des öffentlichen Diskurses ernst zu nehmen sind, dürfen sie nicht für bare Münze genommen werden. Trotz der lautstarken Entrüstung weist Einiges darauf hin, dass diese Art der physischen Auseinandersetzung von vielen als legitimer Teil der politischen Interaktion akzeptiert wurde. Diskursive Polarisierung und praktisches Arrangieren standen in einem Spannungsverhältnis zueinander, das aber nicht zugunsten einer der beiden Alternativen aufgelöst werden kann, sondern selbst als wesentliches Merkmal einer komplexen Konstellation begriffen werden muss.
Schließlich heben die Versammlungen die Vielfalt politischer Partizipationsmodi hervor. Die Vorstellung, dass der Großteil der Bevölkerung im Kontext des sich etablierenden politischen Massenmarkts auf die Rolle eines passiven Konsumenten reduziert wurde, ist nur bedingt tragfähig. Richtig ist, dass der Aspekt der diskursiven Interaktion nicht nur zwischen den verschiedenen Lagern, sondern auch zwischen dem Redner und seinem Publikum um die Jahrhundertwende in den Hintergrund gedrängt wurde. Neben den neuen quantitativen Dimensionen der Versammlungen spielte dabei auch die Logik einer sich verändernden Medienlandschaft eine Rolle, die immer stärker auf die Figur des „großen“ Redners fokussiert war. Doch auch wenn das Versammlungspublikum nur noch selten individuell zu Wort kam, war es keineswegs passiv. Einerseits wurde seine Bedeutung als Resonanzkörper gerade gesteigert, da die Lautstärke und Energie der Publikumsreaktionen zum performativen Ziel der Veranstaltung, die Macht des eigenen Lagers zu demonstrieren, wesentlich beitrugen. Darüber hinaus bildete die Praxis der Versammlungsstörung und ihre Verhinderung einen eigenen Partizipationsmodus, durch den sich gerade auch Bevölkerungsschichten, die im Verbalkampf selten gehört wurden, in der politischen Arena bemerkbar machten.
Literatur:
Cossart, Paula, Le Meeting politique. De la délibération à la manifestation, 1868–1939, Rennes 2010
Elias, Norbert, Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, 4. Aufl.,
Frankfurt a.M. 1990
Laufenberg, Heinrich, Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgegend, 2 Bde., Hamburg 1911
Lawrence, Jon, Speaking for the People. Party, Language, and Popular Politics in England, 1867–1914,
Cambridge/New York 1998
Owzar, , Armin, „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. Konfliktmanagement im Alltag des wilhelminischen Obrigkeitsstaates, Konstanz 2006
Richter, Eugen, Im alten Reichstag. Erinnerungen, 2 Bde.,
Berlin 1894
Scheidemann, Philipp, Memoiren eines Sozialdemokraten,
2 Bde., Dresden 1928 Stampfer, Friedrich, Erfahrungen und Erkenntnisse. Aufzeichnungen aus meinem Leben, Köln 1957
