Das Kaiserreich als System kompromisshafter Entscheidungen
Wolfram Pyta
I.
Wolfgang Mommsen hat in einem einflussreichen Aufsatz das Kaiserreich als „System umgangener Entscheidungen“ bezeichnet. Ich möchte zeigen, dass man diesen Ansatz produktiv weiterentwickeln kann, wenn man eine systemisch verankerte Disposition zum Kompromiss zum analytischen Ausgangspunkt einer Neubetrachtung des Kaiserreichs macht. Meine im Folgenden schlaglichtartig ausgebreitete These ist eine doppelte: Erstens – In das politische System des Kaiserreichs war der Kompromiss strukturell eingeschrieben. Zweitens – Dass vor allem die parlamentarischen Eliten des Kaiserreichs den Kompromiss zur Leitschnur ihres Handelns erhoben, war darauf zurückzuführen, dass sie eine Kultur des Kompromisses internalisiert hatten.
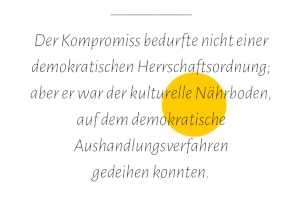
Eine solche Neuakzentuierung verlangt eine präzise Bestimmung des Schlüsselbegriffs „Kompromiss“. Unter Rekurs auf terminologische Offerten aus der politikwissenschaftlichen governance-Forschung wird „Kompromiss“ wie folgt definiert: Kompromiss ist ein institutionalisierter Modus einer auf Entscheidung ausgerichteten Handlungskoordination.Kompromiss beinhaltet damit sowohl eine Prozess- als auch eine Ergebniskomponente: Der Kompromiss strukturiert Verfahrensabläufe, indem er den Interessenausgleich zum Fluchtpunkt erhebt. Die Beteiligten eines solchen Verfahrens qualifizieren sich durch die von ihnen ausgeübten politischen Ämter. Kompromiss ist nicht gleichzusetzen mit ergebnisoffener Deliberation, weil er auf die Herstellung von Entscheidungen abzielt, die den legitimatorischen Vorzug besitzen, dass sie alle Verfahrensbeteiligten binden.
Die Entscheidungsförmigkeit des Kompromisses erlaubt es, die Frage nach „Kulturen des Entscheidens“ anzuschließen und damit die Ausgangsfrage des gleichnamigen Münsteraner SFB aufzugreifen. Eine Kultur des Kompromisses setzt den Rahmen, in dem kompromissförmige Entscheidungen nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich sind. Insofern zählt Kompromisskultur zu der von Karl Rohe und anderen Forschern analysierten Inhaltsseite der politischen Kultur.
Wenn man dem Kaiserreich sowohl eine Disposition zum Kompromiss als auch eine korrespondierende Kompromisskultur attestiert, hat dies für die Einschätzung sowohl des politischen Systems als auch der kulturellen Verfasstheit zwei Konsequenzen: Das politische System des Kaiserreichs ist in Einklang mit der governance-Forschung als ein Verhandlungssystem zu bezeichnen, in dem keine Person, Institution oder herrschaftsaffineGruppierung einen dominierenden Einfluss ausübte, der dieses auf Ausgleich gepolte System aushebelte.
Dieser Befund stellt nicht in Frage, dass Bismarck eine herausragende herrschaftliche Stellung einnahm; er stellt auch nicht in Abrede, dass Wilhelm II. zeitweise mit seinem „Persönlichen Regiment“ eine gestalterische Wirkung ausübte; und er negiert ebenfalls nicht die extrakonstitutionelle Stellung des Militärs, das sich kompromisshaften Verfahren entzog. Es wird auch nicht postuliert, dass das Kaiserreich zwangsläufig eine Entwicklung zu einer parlamentarischen Monarchie einschlug. Denn auch unter den Bedingungen einer entwickelten konstitutionellen Monarchie – mit einem vorbildlich demokratischen Männerwahlrecht – konnte sich der Kompromiss als Verfahren einbürgern wie kulturell gelebt werden.
Der Kompromiss bedurfte nicht einer demokratischen Herrschaftsordnung; aber er war der kulturelle Nährboden, auf dem demokratische Aushandlungsverfahren gedeihen konnten. In dieser Hinsicht stellte das Deutsche Kaiserreich der ersten deutschen Demokratie – der Republik von Weimar – eine günstige politisch-kulturelle Grundausstattung zur Verfügung. Wenn man – wie es jüngst Hedwig Richter überzeugend unternahm – das Kaiserreich in die Kontinuität deutscher Demokratiegeschichte einbettet, gehört das im Kaiserreich praktizierte Kompromissdispositivessentiell dazu.
II.
Die Validität der hier präsentierten These hängt davon ab, ob sich wichtige Politikfelder identifizieren lassen, in denen Kompromiss als systemische Notwendigkeit verankert war. Es ist kein Zufall, dass zwei solcher Politikfelder zum Kernbereich demokratischer Verfassungsstaaten zählen: nämlich das Gesetzgebungsverfahren als Kernstück parlamentarischer Mitwirkung sowie die Reichstagswahlen als Ausdruck demokratischer Partizipation.
Im Kaiserreich ging die Regierung nicht aus dem Schoße einer parlamentarischen Mehrheit hervor und stützte sich daher nicht auf eine Koalition hinter ihr stehender Fraktionen. Aber genau diese Entkoppelung von Reichsleitung und Parlamentsmehrheit machte jedes Gesetzgebungsverfahren zu einem Ringen um eine kompromissförmige Lösung. Es waren die Fraktionen als die Aktionseinheiten des Parlamentarismus, die seit den späten 1870er Jahren bei vielen Gesetzesvorlagen kompromisshafte Entscheidungen trafen.
Als geborener Brückenbauer und damit als Kompromisspartei par excellence fungierte dabei die Fraktion der katholischen Zentrumspartei. Das Zentrum hatte den Kompromiss als Leitbild internalisiert und wirkte in diesem Sinne auch bei der Weichenstellung in der Finanzpolitik im Jahre 1879 mit, als ein Ausgleich divergierender Interessen zu finden war. Der erzielte Ausgleich – die sogenannte Franckensteinsche Klausel – ist nach dem Fraktionsvorsitzenden der Zentrumsfraktion benannt und kann als geradezu paradigmatischer Kompromiss gelten, bei dem das Reich eine Erhöhung seiner Einnahmen erzielte, das Parlament sein jährliches Budgetbewilligungsrecht verteidigte und die Einzelstaaten ihre Finanzhoheit behaupteten.
In der parlamentarischen Behandlung der Wehrvorlage in den Jahren 1912 und 1913 kulminierte diese Entwicklung. Es ging dabei nicht um die Zustimmung zu einer erheblichen Vermehrung der Stärke des Heeres, sondern um die Frage der Finanzierung dieser Rüstungsvorlage. Dies fiel in die Kernkompetenz des Reichstags; und der Umgang mit dieser Frage ist ein Musterbeispiel dafür, dass sich kompromissunfähige parlamentarische Akteure in selbstgewählte politische Isolation begaben, während ehemalige Außenseiter durch Kompromissbereitschaft in das System integriert wurden.
Dass der Reichstag die ihm inhärenten Kompromissmechanismen in der Frage der Finanzierung einer großen Rüstungsvorlage aktivierte, hing damit zusammen, dass der Bundesrat keine kraftvolle Gestaltungsvorgaben machte. Das Organ der Mitwirkung der Einzelstaaten an der politischen Willensbildung im Reich überließ dem Nationalparlament die Initiative. Im Reichstag formierten sich gemäß dem Kompromissmechanismus flexible Mehrheiten, um eine vom Parlament selbst ausgehende Vorgabe zu erfüllen. Es waren die Fraktionsvorsitzenden von Nationalliberalen und Zentrum – Bassermann und Erzberger –, die im Juni 1912 ein nach ihnen benanntes Gesetz durchbrachten, wonach bis zum Frühjahr 1913 die Deckungsvorlagen verabschiedet werden sollten. Damit zwangen sie den Reichstag auf Kompromisskurs, indem sie ihn unter Zeitdruck setzten. Denn indem sie ein enges Zeitkorsett schnürten, produzierten sie einen Entscheidungszwang, der angesichts der Mehrheitsverhältnisse eine kompromissförmige Lösung strukturell herbeiführte.
Die Finanzierung der Wehrvorlage führte zu einem Paradigmenwechsel in der Finanz- und Steuerpolitik des Kaiserreichs, deren Wurzeln im „Kompromiss Bassermann-Erzberger“ verankert waren. Denn dieser sah vor, dass die Mehrausgaben nicht – wie in der Vergangenheit – durch die Erhöhung von indirekten Steuern, welche die breite Masse aufbrachten, erfolgten, sondern allein durch Besitzsteuern, die ausschließlich Vermögende trafen.
Die parlamentarische Behandlung der Deckungsvorlage im Frühjahr/Sommer 1913 zeugt davon, welchen Reifegrad kompromissförmiges Handeln erreicht hatte. Denn nahezu alle Fraktionen suchten auf Basis der Vorgaben der Lex Bassermann-Erzberger nach einem kompromissförmigen Ausweg und schnürten dazu ein Finanzpaket aus einem einmaligen Wehrbeitrag und einer regelmäßig zu erhebenden Vermögenszuwachssteuer, die neben Einkommen und Besitz auch erstmals durch Erbfall entstehende Vermögenszuwächse steuerlich erfasste. Dass sich Nationalliberale, Linksliberale, katholische Zentrumspartei und erstmals auch die Sozialdemokraten auf eine solch Paketlösung verständigten, war die politische Krönung einer bereits seit langem praktizierten parlamentarischen Kompromisskultur.
Der praktizierte Kompromisszwang bedeutete zugleich, dass sich parlamentarische Gruppierungen selbst isolierten, wenn sie in zentralen Sachfragen nicht kompromissbereit waren. Dieses Schicksal widerfuhr den beiden konservativen Fraktionen, die sich vergeblich gegen den Besitzsteuerkompromiss stemmten und sich damit selbst marginalisierten. Nicht das Deutsche Kaiserreich steckte 1913 in einer Krise; vielmehr war es der preußisch-deutsche Konservatismus, der sich im Reich in einer strategischen Isolierung befand.
Umgekehrt hatte im Jahre 1913 die SPD durch ihre Zustimmung zum Besitzsteuerkompromiss den Beweis dafür angetreten, dass sie zu produktiver Mitgestaltung des politischen Systems fähig und auch willens war. Die endgültige politische Integration der Partei der sozialistischen Arbeiterbewegung erfolgte über den Nachweis ihrer Kompromissbefähigung. Und da die SPD damit ausgerechnet für die Finanzierung einer von ihr strikt abgelehnten Heeresvermehrung den Weg ebnete, war die politische Zumutung für eine sich als antimilitaristisch verstehende Partei nicht gering gewesen.
III.
Dass die SPD-Fraktion im Jahre 1913 diesen qualitativen Schritt wagte und erstmals Gesetzesvorhaben im Reichstag ihre Zustimmung erteilte, war auch darauf zurückzuführen, dass die Parteiorganisation schon seit längerem den Kompromiss auf Ebene des Wahlverfahrens eingeübt hatte. Damit sind wir beim zweiten kompromissfördernden Strukturprinzip des Kaiserreichs angelangt: einem Wahlrecht, das einen Kompromisszwang mit sich führte, weil es zu Wahlabsprachen nötigte.
Im Laufe des Kaiserreichs wurden Wahlbündnisse immer erforderlicher, weil sich immer weniger Bewerber direkt im ersten Wahlgang durchsetzen konnten. Bei der Reichstagswahl 1912 kam es in 299 von insgesamt 397 Wahlkreisen zu Wahlbündnissen in Stichwahlen. Diese Wahlbündnisse zeichneten sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Eine feste Blocklogik war die Ausnahme; im Regelfall gehorchten Wahlbündnisse auf lokaler und regionaler Ebene einer taktisch bedingten Logik eines Aushandlungssystems, bei dem es darauf ankam, die Wahlchancen der jeweiligen Parteien zu optimieren.
Dies lief darauf hinaus, bereits bei der Kandidatenaufstellung in vielen Fällen darauf zu achten, dass Wahlkreiskandidaten auch für Wähler anderer Parteien wählbar waren. Dieser Mechanismus bewirkte, dass in umkämpften Wahlkreisen häufig Kandidaten nominiert wurden, die potentiellen Bündnispartnern vermittelbar waren. Dies bedeutete, dass die Auswahl von Reichstagskandidaten in nicht wenigen Fällen darauf ausgerichtet wurde, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes als Kompromisskandidaten fungierten und nicht als Parteisoldaten.
Bei der Aufstellung solcher Kompromisskandidaten waren verschiedene politische Kombinationen denkbar: Bei der Stichwahl 1912 schlossen Linksliberale und SPD sogar ein formelles Abkommen, um sich gegenseitig in bestimmten Wahlkreisen zu unterstützen. Die Zentrumspartei war nach allen Seiten offen und konnte in der Stichwahl sowohl Sozialdemokraten als auch Liberalen wie 1912 in Karlsruhe Ludwig Haas, der mosaischen Glaubens war, zum Wahlerfolg verhelfen. Dies hing entscheidend von der Persönlichkeit und vom politischen Profil des jeweiligen Kandidaten ab.
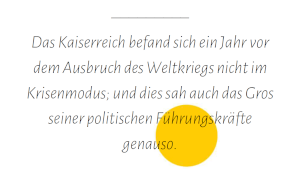
Taktische Wahlkompromisse verlangten sich daran beteiligenden Parteien auch einen politischen Preis ab. Denn wenn – was häufig vorkam – Parteien bereits im ersten Wahlgang auf die Aufstellung eigener Kandidaten verzichteten und zugunsten aussichtsreicherer Kandidaten anderer Parteien zurückzogen (sogenannte „Aussparungsabkommen“), dann reduzierten sie durch eigenes Zutun den prozentualen Anteil der auf sie entfallenden Stimmen. Damit stellten sie sich schlechter als sie in Wirklichkeit waren, weil sie dem Kompromissgedanken Vorrang vor der Maximierung der Stimmenzahl einräumten.
Verhielten sich in den Reichstag gewählte „Kompromisskandidaten“ kompromissbereiter als jene, die ohne Rücksichtnahme auf Leihstimmen aus anderen Parteien aufgestellt waren? Hier ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten; aber erste Befunde deuten darauf hin, dass dies insbesondere für die Abgeordneten der beiden liberalen Parteien (Nationalliberale und Linksliberale) zutraf, die sich ohnehin immer schwertaten, einen Wahlkreis ohne Schützenhilfe anderer Parteien zu erobern.
Wahlkompromisse wirkten sich auf die Wahlbeteiligung nicht demobilisierend aus. Es war nicht so, dass in der Stichwahl die Wähler der ausgeschiedenen Kandidaten massenhaft der Wahlurne fernblieben, statt der Stichwahlparole ihrer politischen Heimat zu folgen. Dies deutet darauf hin, dass die Kompromisskultur Teil einer allgemeinen Wahlkultur war und die Wähler der meisten Parteien darin geübt waren, ihre politischen Präferenzen auch in Gestalt einer kompromisshaften Wahlkultur kundzutun.
IV.
Das dritte Politikfeld, das strukturell für den Kompromiss disponiert war, war der Föderalismus. Er bewirkte komplexe Aushandlungsprozesse, die sich institutionell vor allem im Wirken des Bundesrats niederschlugen. Der Bundesrat fungierte als ein auf Kompromiss geeichtes Verfassungsorgan, weil Preußen den mittelstaatlichen Bundesmitgliedern (insbesondere dem faktisch über ein Vetorecht verfügenden Bayern) seinen Willen nicht aufzwang.
Als institutionalisierter Vermittlungsausschuss hat der Bundesrat im Regelfall immer einen kompromisshaften Ausweg gefunden, um nicht als Blockierer von Entscheidungen zu fungieren. Kompromisse wurden in schwierigen Situationen immer dann geschlossen, wenn sich eine Institution nicht in den Zustand der Entscheidungsunfähigkeit versetzen wollte. Dies traf auch für den Bundesrat zu – vor allem in der Zerreißprobe im März 1913, als es um die Frage der Finanzierung der Wehrvorlage ging.
V.
Man wird schwerlich dem Befund widersprechen, dass der Kompromiss in semantischer Hinsicht strukturelle Nachteile aufwies. Im Wortschatz des Kompromisses war kein Platz für politische Fahnenwörter, die mit ihrer Signalwirkung Themen plakativ markierten und daher die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren vermochten. Dem Kompromiss war mithin eine Semantik wesensfremd, die polarisierte und aufrüttelte; stattdessen war er von einer sterilen Nüchternheit geprägt, was auch darin zum Ausdruck kam, dass mangels Alternativen Kompromisse nicht nur gelegentlich nach denjenigen Protagonisten benannt wurden, welche sie ausgehandelt hatten. Als sich der Reichstag im Frühjahr 1912 auf die Erhöhung von Besitzsteuern zur Finanzierung der Heeresaufrüstung verständigte, wurde der entsprechende Kompromiss nach seinen Urhebern „Kompromiss Bassermann-Erzberger“ getauft.
Die fehlende semantische Prägnanz hat allerdings dem Kompromiss nicht geschadet. Seine Vertreter gerieten nicht in Legitimationsschwierigkeiten, wenn sie ihren Anhängern die Entscheidung eines Aushandlungsprozesses als Sachkompromiss kommunizierten und ihnen dafür keine prägnanten Worte zur Verfügung standen.
Über die Gründe hierfür lassen sich bislang nur Mutmaßungen anstellen. Denn es fehlt bislang an sprachwissenschaftlichen Untersuchungen über die Genese und die Verwendung dieses Terminus in der politischen Sprache. Doch kursorische Lektüren vermitteln den Eindruck, dass dieser Begriff schon in den 1860er Jahren abrufbar war als Bezeichnung für ein Aushandlungsverfahren, an dessen Ende eine Entscheidung stand. Daher spricht vieles dafür, dass sich bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Kultur des Kompromisses ausgebreitet hatte, die so verfestigt war, dass Kompromisspolitiker keinen gesonderten Begründungsaufwand betreiben mussten, wenn sie eine auf Kompromiss ausgerichtete Politik betrieben.
VI.
Wie wird man den Faktor Kompromiss in deutsche Traditionen politischer Kultur und praktischer Politik einordnen können? Der Befund, dass die Kompromissfähigkeit der politischen Eliten des Kaiserreichs – nicht nur der parlamentarischen Eliten – im Jahre 1913 einen Höhepunkt erreicht hatte, entschärft jede dem Kaiserreich attestierte Krisendiagnose. Das Kaiserreich befand sich ein Jahr vor dem Ausbruch des Weltkriegs nicht im Krisenmodus; und dies sah auch das Gros seiner politischen Führungskräfte genauso.
Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass der Erste Weltkrieg auch in Hinsicht auf die Geltung der Kompromisskultur einen tiefen Einschnitt darstellte. Er gab einem agonalen Politikverständnis Auftrieb, das in seinem Freund-Feind-Denken strukturell jedem Kompromiss abhold war. Er etablierte in seiner Verarbeitung eine auf Militanz ausgerichtete Performanz politischer Auftritte, deren semantisches Kennzeichen eine ausufernde Kraftsemantik war. Er erhöhte den Bedarf an symbolischer Politik, für welche der Kompromiss ebenfalls ungeeignet war.
Der Kompromiss verfügte über eine Zählebigkeit, die ihm in der zweiten deutschen Demokratie seine Renaissance erleichterte. In der nüchternen, jeder Theatralik abgeneigten Bonner Republik konnte sich der Kompromiss unspektakulär vor allem in der parlamentarischen Praxis seit den 1950er Jahren entfalten. Er ist somit zum Markenzeichen einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie geworden.
