Vom Umgang mit der Reichsgründung in der
deutschen Geschichte nach 1871
Ulrich Lappenküper
I.
„Wir stehen heute fest auf dem Fundament der Freiheitsbewegung und der Demokratiegeschichte“, beteuerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 3. Oktober 2020 in einer Rede zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit – und fügte dann erläuternd hinzu: „Wir berufen uns auf die Ideen des Hambacher Festes, der Paulskirche, der Weimarer Demokratie, des Grundgesetzes und der Friedlichen Revolution“ von 1989/90. Vom Kaiserreich war in Steinmeiers Aufzählung nicht die Rede, und das Staatsoberhaupt machte auch keinen Hehl daraus, warum: Die deutsche Einheit sei „nach Kriegen mit unseren Nachbarn“ erzwungen worden, anschließend hätten die Regierungen „mit eiserner Hand“ „durchregiert“, und nur „ein kurzer Weg“ habe „zur Katastrophe des Ersten Weltkriegs geführt“.
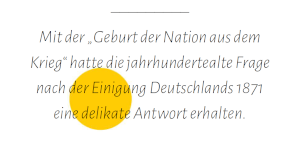
Ganz ähnlich düster klingt es in dem neuen Buch des Marburger Historikers Eckart Conze über „Die Schatten des Kaiserreichs“. Doch wir vernehmen auch andere Stimmen, etwa die des Publizisten Klaus-Jürgen Bremm, der die Reichsgründung in einem Buch über „70/71“ als „europäischen Glücksfall“ feiert, oder des Passauer Geschichtswissenschaftlers Hans-Christof Kraus, der jüngst beteuerte: Auf die Reichsgründung dürfe man „auch nach 150 Jahren noch stolz sein“, nicht auf den Krieg gegen Frankreich, wohl aber „auf das, was daraus folgte“.
Man könnte den Eindruck gewinnen, als ob unserer Zunft ein neuer Streit bevorsteht. Ob er die Forschung so zu befruchten vermag wie die Fischer-Kontroverse der 1960er-Jahre oder so entzweien wird wie der Historikerstreit der 1980er-Jahre, ist noch nicht ausgemacht.
II.
„Deutschland? aber wo liegt es?“ fragte Friedrich Schiller 1796 in seinen berühmten Xenien. „Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.“ Als die Deutschen Schillers Sehnsuchtsort, das „Deutsche Reich“, ein Dreivierteljahrhundert später gefunden hatten, brachen nicht alle in Freudentaumel aus. Vertretern des politischen Katholizismus missfiel die kleindeutsche, unitarisch anmutende Lösung der deutschen Frage, bayerische Patrioten und Welfen befürchteten eine Verpreußung, Zentrumspolitiker wie Ludwig Windthorst oder Sozialdemokraten wie August Bebel kritisierten die Nationalstaatsgründung durch Krieg oder die Mängel im politischen System.
Mit der „Geburt der Nation aus dem Krieg“ (Frank Becker), daran kann kein Zweifel bestehen, hatte die jahrhundertealte Frage nach der Einigung Deutschlands 1871 eine delikate Antwort erhalten: vom Ausland misstrauisch beäugt und auch im Innern nicht überall begrüßt. Doch ebenso richtig ist es zu konstatieren, dass die Reichsgründung nicht nur mit der wohlwollenden Neutralität der Großmächte, sondern auch mit breiter Zustimmung des deutschen Volkes erfolgt war. Schon drei Wochen vor der Kaiserproklamation hatte der Reichstag des Norddeutschen Bundes eine Deputation nach Versailles entsandt, um Preußens König die Kaiserkrone anzutragen. Wilhelm I. nahm das ihm am 18. Dezember 1870 notabene vom ehemaligen Präsidenten der Frankfurter Paulskirche, Eduard von Simson, überbrachte Angebot nach einigem Zögern so wohlwollend an, dass sein Schwiegersohn Friedrich I. von Baden dieses Datum zu einem „Ehrentag für Deutschland“ erhob.
Die Reichsgründung war eben trotz eines fehlenden direkten Akklamationsaktes des Volkes mitnichten nur ein Akt von oben! Sie war jedoch auch nicht alternativlos, aber keine der übrigen Optionen besaß eine wirkliche Chance zur Realisierung. Hätte Deutschland also, um des Friedens mit Frankreich willen, auf den kleindeutschen Nationalstaat verzichten sollen, wie Tillmann Bendikowski jüngst suggeriert?
III.
Mit der verfassungsmäßigen Verankerung von Kaiser und Reich lebte in Deutschlands politischer Semantik nicht nur die alte Kyffhäuser-Sehnsucht der Romantik, sondern auch das Streben der 48er wieder auf. Ungeachtet aller Bemühungen, die Kaiser- und Reichsidee „als föderativen und großdeutschen Schutzschild gegen den kleindeutsch-preußischen Unitarismus“ in Stellung zu bringen (Dieter Langewiesche), legte der universale Reichsgedanke dem jungen Nationalstaat eine schwere Bürde in die Wiege. Belastend wirkte außerdem der Primat der Einheit gegenüber der Freiheit, wiewohl dank des Wahlrechts, der Rechtsstaatlichkeit, des Parteienwesens oder der Pressefreiheit etliche demokratische Elemente ins politische System Einzug hielten. Noch ein weiteres, wenngleich nicht auf Deutschland beschränktes Problem gärte im Kaiserreich: Mit dem sich verschärfenden Nationalismus ging seit den 1880er-Jahren eine Wendung des Reichsgedankens ins Imperiale einher, durch die sowohl die von Wilhelm I. proklamierte Rolle Deutschlands als „zuverlässiger Bürge des europäischen Friedens“ als auch Bismarcks Politik der „Saturiertheit“ konterkariert wurden. In einem bewusst an das Zeremoniell der Versailler Kaiserproklamation von 1871 erinnernden Festakt fasste Wilhelm II. seine Gedanken 1896 in die stolzen Worte: „Aus dem Deutschen Reiche ist ein Weltreich geworden.“
IV.
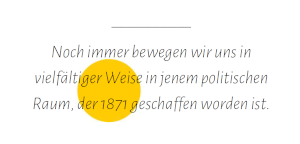
Und dennoch: Nicht einmal der ruhmlose Untergang der Monarchie 1918 sollte den Reichsgedanken diskreditieren. Neben einer in der Gesellschaft fortlebenden Anhänglichkeit gegenüber dem 1806 untergegangenen Alten wie dem 1871 gegründeten Zweiten Reich spielte dabei wohl auch die Tatsache eine Rolle, dass mancher Deutsche die Weimarer Republik geradezu als „Antithese“ des Kaiserreichs ansah (Kurt Sontheimer). Zur 50. Wiederkehr der Kaiserproklamation bezeichnete der Herzens-Monarchist und Vernunft-Republikaner Gustav Stresemann es 1921 in einer flammenden Rede als Bismarcks Vermächtnis, unermüdlich daran zu wirken, dass das Reich eines Tages in seiner alten Größe wiedererstehe.
In den folgenden Jahren erlangte der Mythos vom Reich eine immer größere, aber auch diffusere Bedeutung. Sie umfasste den Ruf der Deutschnationalen nach einer Rückkehr zum Bismarckreich wie auch das Plädoyer der Abendländischen Bewegung für eine deutsche Führungsrolle in Mitteleuropa. Die Nationalsozialisten bedienten sich zunächst des von Arthur Moeller van den Bruck geprägten Topos vom „Dritten Reich“, schwenkten dann aber auf den national entgrenzten Begriff eines „Großgermanischen Reiches deutscher Nation“ (Walter Hofer) um und unterfütterten ihn mit völlig verblendeter Rassenideologie.
V.
Trotz der bedingungslosen Kapitulation bestand Deutschland nach 1945 völkerrechtlich in den Grenzen von 1937 fort. Eine Benennung des westdeutschen Provisoriums als Reich kam für die Mütter und Väter des Grundgesetzes im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern der Weimarer Nationalversammlung indes nicht in Frage – wohl weniger aus innerer Überzeugung, denn aus Rücksicht auf das Ausland. Indem der Parlamentarische Rat die Bundesrepublik jedoch als identisch mit dem als handlungsunfähig deklarierten Deutschen Reich definierte, öffnete er das Tor zu einem intensiven Diskurs, der in den 1950er-Jahren von fünf Argumentationslinien bestimmt wurde:
- der von der rechtsextremen „Deutschen Reichspartei“ formulierten Forderung nach einer Wiedererrichtung eines völkisch homogenen Reichs;
- der von einer politisch-emotionalen Reichstreue getragenen Hoffnung auf ein Wiedererstehen des Reichs in der Form einer sozialistischen Republik (man denke an Kurt Schumacher) oder einer christlich geprägten „Brücke zwischen Ost und West“ (à la Jakob Kaiser);
- der etwa von Friedrich Meinecke oder Thomas Mann gezogenen Kontinuitätslinie vom Kaiserreich zum „Dritten Reich“;
- der von den Repräsentanten des „neuen“ Abendlandgedankens vertretenen Ansicht, das Kaiserreich habe seinen Namen vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bloß usurpiert, und
- dem von Konrad Adenauer und seinen Anhängern gefällten Verdikt, im Kaiserreich habe „anstelle der sittlichen Idee der nationalen Freiheit […] ein auf die Macht gegründeter Nationalismus“ den Ton angegeben.
Auf welch‘ schwankendem Boden sich die Debatte im politisch-gesellschaftlichen Raum bewegte, verdeutlichte der 80. Jahrestag der Reichsgründung. Die Bundesregierung zeigte sich unfähig, die selbst gestellte Frage nach einem öffentlichen Gedenken konsensual zu beantworten. Ganz anders agierte der Bundestag bzw. dessen Präsident Hermann Ehlers, der es als selbstverständlich erachtete, an das Jubiläum zu erinnern. Unter lebhaftem „Beifall [der Abgeordneten] in der Mitte und Rechts“ – so vermerkt es das Protokoll – betonte Ehlers am 18. Januar 1951, dass die Deutschen der Reichsgründung im Willen um Frieden und um die Zugehörigkeit zur europäischen Gemeinschaft sehr wohl „als eines bedeutsamen Ereignisses unserer Geschichte in Achtung gedenken“ könnten.
Schenkt man einer Umfrage der Wochenzeitung „Die Zeit“ aus diesem Jahr Glauben, traf Ehlers damit nicht nur die Stimmung der Abgeordneten: 45 % der Befragten bezeichneten das Kaiserreich vor 1914 als jene Zeit, in der es Deutschland im 20. Jahrhundert am besten gegangen sei.
Das von Ehlers implizit artikulierte Bemühen, Adenauers Politik der Westintegration mit einer gesamtdeutsch orientierten Symbolpolitik zu verbinden, mündete 1954, ein Jahr nach dem Volksaufstand in der DDR, in die Ausrufung des 17. Juni zum Tag der deutschen Einheit, der am selben Tag die Gründung des Kuratoriums Unteilbares Deutschland folgte. Adenauer hielt sich von den Aktivitäten des Kuratoriums weitgehend fern, weil ihm dessen Ziele zu stark am Reich Bismarcks und zu wenig an Europa orientiert waren. Nachdem das westdeutsche Provisorium durch die Pariser Verträge von 1955 seines Erachtens nach die Souveränität zurückerlangt hatte, gab der Kanzler der europäischen Integration den klaren Vorrang vor der Wiedervereinigung. Anhänger der Abendlandbewegung wie Paul Wilhelm Wenger gingen noch einen Schritt weiter, indem sie die nationalstaatliche Entwicklung Europas seit 1789 als Irrweg bezeichneten. Für den Publizisten wie für den Kanzler galt freilich gleichermaßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956, wonach das Reich „als staats- und völkerrechtliches Subjekt nicht untergegangen“ und die Wiederherstellung der deutschen Einheit ein „vordringliches nationales Ziel“ sei.
VI.
Wie diffizil die gesellschaftliche und politische Debatte auch fünf Jahre später noch war, verdeutlichte der 90. Jahrestag der Reichsgründung 1961. Einen von Bundesinnenminister Gerhard Schröder im Kabinett angeregten Gedenkaufruf lehnte Adenauer mit dem Argument ab, es gebe „kaum ein Reich, das so kurz bestanden“ habe. Zwar mochte ihm von Seiten der Minister niemand widersprechen, doch national orientierte Christdemokraten, aber auch Liberale vom Schlage eines Thomas Dehler oder Reinhold Maier warnten vor der Preisgabe der Reichsidee. Der Bundestag reagierte auf ihre Mahnungen mit einer Gedenkstunde, in der Präsident Eugen Gerstenmaier sein Bekenntnis zum Fortbestand des Reiches mit einem Plädoyer zu einer „redlichen Hinwendung zu der Gemeinschaft mit unseren Nachbarvölkern und der freien europäisch-atlantischen Welt“ verband.
| ––––––––– Noch immer bewegen wir uns in vielfältiger Weise in jenem politischen Raum, der 1871 geschaffen worden ist. |
Allen Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zum geeinten Nationalstaat wurde durch den Bau der Berliner Mauer im August 1961 ein schwerer Schlag versetzt, und dennoch hielt das Gros der Bundesbürger nicht nur am Fortbestand der Nation fest, sondern auch an einer weitgehend positiven Konnotation des Kaiserreiches. Noch 1965 gab der Vorsitzende der SPD Willy Brandt zu Bismarcks 150. Geburtstag unumwunden zu, dass zu „Stolz“ bei der Gründung des Deutschen Reiches „doch wirklich Grund“ gewesen sei. Bundeskanzler Ludwig Erhard ließ es sich anlässlich eines Festakts im Bundestag nicht nehmen, die Festrede auf den „großen Staatsmann“ zu halten. Von der in Teilen der Gesellschaft – bei bayerischen Regionalisten, konservativen Katholiken, großdeutschen Traditionalisten und kritischen Historikern – mittlerweile vorhandenen Distanz zu Reich und Reichsgründer waren Erhard wie auch Brandt weit entfernt. Erst der Machtwechsel von 1969 ließ den gesellschaftlichen Konsens bröckeln.
VII.
Von der Staatsspitze unterstützt, strebte die sozialliberale Koalition parallel zur Wende in der Deutschlandpolitik eine geschichtspolitische Neugründung der Republik an – die indes nicht allen gefiel. Als Bundespräsident Gustav Heinemann 1971 am Vorabend des 100. Jahrestages der Kaiserproklamation in einer Fernsehansprache eine teleologische Linie von der Reichsgründung bis zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zog, löste er einen geschichtspolitischen Skandal aus.
„Hundert Jahre Deutsches Reich“, so lautete sein eindringliches Credo, „– dies heißt eben nicht einmal Versailles, sondern zweimal Versailles, 1871 und 1919, und dies heißt auch Auschwitz, Stalingrad und bedingungslose Kapitulation von 1945.“
Einen markanten Kontrapunkt setzte der zweite Mann im Staat, Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel, indem er im Hohen Haus dazu aufrief, an das Recht auf Einheit in Freiheit zu erinnern, „dies freilich nicht in nationalstaatlichen Denkkategorien des 19. Jahrhunderts“.
Das sozial-liberale Bundeskabinett sah wie seine christdemokratisch-liberalen Vorgänger von einer Gedenkveranstaltung ab, stimmte aber nicht nur der Prägung einer Gedenkmünze und einer Briefmarke zu, sondern ließ auch durch Bundesminister Egon Franke am 18. Januar einen Kranz am Grabe des ersten Reichskanzlers in Friedrichsruh niederlegen. Bundeskanzler Brandt würdigte die Reichsgründung zur selben Stunde in Bonn als „Werk Bismarcks, eines der großen Staatsmänner unseres Volkes“. Zwar könne die militärische Lösung der deutschen Frage „heute kein Vorbild“ mehr sein, habe aber „den damaligen Einsichten und Möglichkeiten“ entsprochen. Für Teile der deutschen Presse war dies bereits zu viel des Lobes, auch wenn nicht alle Blätter gleich einen „Tag der Trauer“ ausriefen wie die „Süddeutsche Zeitung“.
VIII.
Seit dem Abschluss des Grundlagenvertrags mit der DDR 1972 schälte sich im gesellschaftlichen wie politischen Diskurs ein zunehmend schärferer Zwist über das Erbe des Reiches wie auch über die Zielsetzung der Wiedervereinigung heraus. Während die einen sich am Leitbild der Staatsnation von 1871 orientierten, hoben die anderen auf die Kulturnation ab, deren Wurzeln ins Jahr 1848 wiesen. Obwohl das Bundesverfassungsgericht 1973 abermals dazu aufforderte, die Wiederherstellung der deutschen Einheit auf dem Territorium des Reiches als politisches Ziel nicht aufzugeben, schrieb Heinemanns Nachfolger Walter Scheel den Deutschen 1978 ins Stammbuch, dass die Reichsidee nicht mehr Fixpunkt des Einheitsstrebens sein könne. Demgegenüber beteuerte Alt-Bundeskanzler Brandt in einer Rede zur 100. Wiederkehr der Verabschiedung des Sozialistengesetzes, der von Bismarck bestimmte Zeitabschnitt vermittle „nicht nur Niederdrückendes“, sondern auch „Inspirierendes“, denn der „Freiheitsfaden in der deutschen Geschichte – er konnte immer wieder aufgegriffen […] werden“.
Je länger die Deutschen die Existenz zweier deutscher Staaten – ganz im Sinne Brandts – anzuerkennen bereit waren, desto fraglicher schien es, ob das Bismarckreich noch als Referenzmodell ihres Nationsverständnisses taugte. Anlässlich des 110. Jahrestages der Reichsgründung 1981 rief der Publizist Günter Gaus vehement dazu auf, möglichst nicht mehr von einer deutschen Nation zu reden, und provozierte damit eine fast so lebhafte öffentliche Diskussion wie Heinemann zehn Jahre zuvor. Die christdemokratisch-liberale Regierung unter Helmut Kohl hielt nach dem Machtwechsel von 1982 am Ziel der deutschen Einheit fest, meinte indes, über den Nationalstaat Bismarckscher Prägung hinaus denken zu müssen. Als die europäische Einigung mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 neue Gestalt gewann, geriet Kohls Kurs von links wie von rechts unter massiven Beschuss. Konservative Publizisten und Staatsrechtler wie auch nationalgesinnte Christdemokraten warfen ihm vor, das Ziel des vereinten Europa dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes überzuordnen. Der Sozialdemokratie nahestehende Intellektuelle wie Hans-Ulrich Wehler wetterten hingegen über die Wiederentdeckung der „Leiche des 1945 endgültig gescheiterten Bismarckreiches“. Noch radikaler äußerte sich der Grünen-Politiker Helmut Lippelt, der den Begriff einer deutschen Nation ganz aufgeben wollte.
„Nationen sind keine Naturtatsachen. […] Sie sind auf komplizierte Weise historisch entstanden, und sie können historisch auch wieder verwirkt werden.“
IX.
Kaum überraschend, lösten der Mauerfall in Berlin 1989 und die „nationaldemokratische Revolution“ (Hartmut Zwahr) bei manchem Akteur auf der politischen Linken massives Unbehagen aus, und das obwohl die politisch Verantwortlichen beider deutscher Staaten im Einigungsvertrag 1990 klar zum Ausdruck brachten, dass mit der Wiedervereinigung nicht das Bismarckreich zurückkehre. Auch in den Zwei-plus-Vier-Mächte-Verhandlungen ließen die sechs Partner die „juristische Mumie“ des Reiches „achtlos am Wegesrand liegen“ (Christoph Schönberger).
Sieht man einmal von der rechtsextremen Bewegung der „Reichsbürger“ ab, hält die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das vereinte Deutschland seit 1990 für den legitimen Nachfolger des 1871 geschaffenen, 1945 „vergangenen“ Reichs (Klaus Hildebrand): keine „postnationale Demokratie unter Nationalstaaten“ (Karl Dietrich Bracher), wohl aber ein „postklassischer demokratischer Nationalstaat unter anderen“ (Heinrich August Winkler). Dank zahlreicher neuer Forschungen gilt das Kaiserreich nicht nur als die wohl einzig realistische Antwort auf die seinerzeit seit Generationen schwelende deutsche Frage, sondern auch als eine wichtige Etappe auf dem verschlungenen Weg Deutschlands zur Demokratie: über Jahrzehnte eine Friedensmacht in der Mitte Europas und „ein Fortschrittsmodell als Rechts-, Verwaltungs- und Sozialstaat“ (Jörn Leonhard). Weitgehende Einmütigkeit besteht ferner darin, dass die Gründung keineswegs bereits den Keim des Untergangs in sich trug.
Noch immer bewegen wir uns in vielfältiger Weise in jenem politischen Raum, der 1871 geschaffen worden ist: Man denke an die staatlichen Institutionen, das (1918 um das Frauenwahlrecht erweiterte) allgemeine, direkte und geheime Wahlrecht, den Föderalismus, den Rechts- und den Sozialstaat oder den Aufstieg der bürgerlichen Kultur. Ob der 150. Jahrestag der Reichsgründung am 1. Januar 2021 „zu Stolz doch wirklich Grund“ bietet, wie Willy Brandt 1965 bekannte, mag jeder für sich entscheiden. Das Jubiläum sollte aber intensiv dazu genutzt werden, das Bewusstsein der Öffentlichkeit über eine wesentliche Epoche deutscher Geschichte zu schärfen, eine Epoche, der wir den ihr zustehenden Platz im Demokratiegedächtnis der Bundesrepublik nicht versagen sollten.
Literatur:
Bendikowski, Tillmann, 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit, München 2020
Bremm, Klaus-Jürgen, 70/71. Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen, Darmstadt 2019
Conze, Eckart, Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe, München 2020
Epkenhans, Michael, Die Reichsgründung 1870/71,
München 2020
Winkler, Heinrich-August, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000
Wolfrum, Edgar, Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, Göttingen 2001
